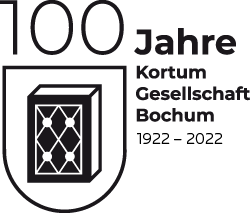Witz und Humor im Westfälischen Industriegebiet
Karl Brinkmann
Dieser Beitrag ist eine verkürzte Fassung des Vortrages, der am 19. Februar 1957 vor der Vereinigung für Heimatkunde gehalten wurde. Ein Teil des verarbeiteten Materials, die volkskundlichen Grundlagen, sind bereits von Bernhard Kleff in den ersten vier Bänden dieses Heimatbuches zusammengetragen worden.
Das Ruhrgebiet erscheint dem ersten flüchtigen Eindruck als große Einheit, als der “Schmelztiegel zahlreicher deutscher Stämme im Feuer des alles beherrschenden Bergbaues und der Schwerindustrie”. Dem genaueren Blick aber zeigen sich dann viele Unterschiede, die auf das ursprüngliche stammesmäßige Gefüge der Bevölkerung zurückzuführen sind. Das jetzige Revier war schon Grenzgebiet zwischen verschiedenen Stämmen, bevor es industrialisiert wurde. Die Grenzen zwischen ripuarischer (bergischer), westfälischer und niederrheinischer Stammeseigenart überschnitten sich vielfach. Im alten Bochum standen das schieferverkleidete bergische Bürgerhaus und der westfälische Fachwerkbau unvermittelt nebeneinander. Doch für den größten Teil des westfälischen Reviers bleibt trotz aller Überfremdung Infolge der regen Zuwanderung eine Grundlage bestehen, auf die sich auch der Hinzugezogene stellen mußte, wenn er wirklich einheimisch werden wollte. Diese war immer westfälisch. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war es für einen zuziehenden fremdsprachigen Bergmann wichtiger, Plattdeutsch zu lernen, als Hochdeutsch. Erst die Zeit nach dem zweiten Weltkriege hat hier viele Wandlungen und eine Unruhe geschaffen, deren Ausgang noch nicht abzusehen ist. Deshalb muß diese Entwicklung hier unberücksichtigt bleiben.
Heinrich Lützeler erinnert in seiner reizvollen “Philosophie des Kölner Humors” daran, daß ein jeder “Jeck” auf seine eigene Weise “jeck” ist. Das gilt aber nicht nur für den Humor, sondern auch für den Witz. Er ist wenn nicht das liebste, so doch das sichtbarste Kind des Humors, jener Lebenshaltung, die auch dort im wirklichen Leben das Bedeutsame und Liebenswerte erkennt wo es klein und widrig erscheint und die damit die Ver-söhnlichkeit entdeckt die sich allem Verstand entzieht und aller Übellaunigkeit verschließt. Das Konversations-Lexikon klärt darüber auf, daß man unter “Humor” “früher die allgemeine Gemütsbeschaffenheit Stimmung, Laune, wobei das Heitere überwiegt,” verstand. Man glaubte ihn durch die Mischung der Säfte, der “humores” im Körper bedingt.
Ein Freund, dem ich diese Definition vorlas, meinte dazu: “Das stimmt. Auf die Mischung der Säfte kommt es an. Aber warum sagt der Mann, das sei früher so gewesen. Ein geringer Protausendsatz Alkohol unter das Blut gemischt genügt, dann überwiegt das Heitere”. Diese Reaktion aber führt uns zum Thema. Sie war typisch in ihrem Kurzschluß, der nicht einmal geistlos war. Der Freund machte einen Witz, der in aller Anspruchslosigkeit weder dem Wunsch nach Aktualität, noch einem satirischen Bedürfnis, sondern einfach der Freude an der absurden Kombination der Vorstellungen entsprang. Nur ein solcher aber kann für unsere Untersuchung als typisch gelten. Der Witz ist auch Kampfmittel, nicht nur gegen die Gewalt des grauen Alltages, sondern auch in politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Als solches aber braucht er nicht “bodenständig“ zu sein, seine Wirkung reicht so weit wie die angegriffenen Zeiterscheinungen reichen. So wandern solche Witze, satirische Zeitschriften, Tageszeitungen und in neuerer Zeit auch der Rundfunk machen sie zum Allgemeingut, das mit den verspotteten Erscheinungen unverständlich wird und verschwindet.
Humor aber wandert nicht, er ist vielfach gebunden: an die stammesmäßige Abkunft an die sozialen Verhältnisse, an den Bildungsstand. Die erste Grundlage bleibt gleich, die zweite und dritte verändert den geistigen Anspruch des aus Humor erwachsenen Witzes, nicht seinen Charakter. Im Revier gibt das Nebeneinander von großen und kleinen Städten, von mehr oder wenig ländlich durchsetzter Bevölkerung verschiedenartigste Ansatzpunkte. Dabei hat in diesem “Schmelztiegel” die westfälische Eigenart sich mit einer Zähigkeit behauptet, die überraschend ist. Was fremd hinzuwanderte und fremd blieb, wurde selbst zur Quelle des Witzes, der oft nicht mehr gutmütig, sondern satirisch, ablehnend, beißend war. Es braucht hier nur an die Fülle der “Stanis-Witze” erinnert zu werden, die einst einen beträchtlichen Teil der Stammtischunterhaltungen ausmachten, heute aber mit den kultursoziologischen Erscheinungen, die sie auslösten, verschwunden oder bedeutungslose Reminiszenz an anno dazumal geworden sind. Vergessen sind sie keineswegs. Man hält im Revier auf Tradition, sogar wenn man sie, soweit nicht vorhanden, mit Gewalt schaffen muß.
Am Anfang der praktischen Beispiele soll ein plattdeutsches Gedicht aus Wilhelm Täppers “Lachpillen, 4. Band”, der 1886 erstmalig erschien, stehen. Der Verfasser stammt aus Holsterhausen, war lange Lehrer in Bochum und schrieb hier auch dieses Gedichtchen. Es ist “De aftrünnige Esel”:
“Dör Reckelhusen deh süß stets
Ein Möhlenknech met Esels gohen.
De lait he do dann jedesmol
An‘n längst bekannte Schenke stohen.
He resten sick en Pöösken do
Van sinem schworen Dagewerke.
Grad tegenöwer vann‘et Hus
Do lagg de evangelske Kerke.
Eens stunn do grad de Dühr wat loß. –
As dat so‘n groten Schlacks geseihen,
Dee eenen van de Esels he
Ganz heemlich in‘ne Kette leihen.
Bold kamm der Möhlenknech herut
Un tallt ers sine grisen Kunnen,
Do fand tau sinem Schrecken he,
Dat een was vannen Trupp verswunnen.
“De Deuwel!” sagg he, “wo es doch
Dat olle Dier woll fottgekommen?
Dat hett he doch, so olt he is,
Noch nümmer sick herutgenommen!”
Drop sooch de Knech, un as he bold
Sick hadd de Ogen blind geseihen,
Do hören van de Kerke ut
He den verlornen Grisrock schreien.
Gliek was he dor un tog em dann
So een‘ge Fasten dör de Flanken
Un reip: “Paß op! Ich brenge doch
Di Oos op annere Gedanken.
Bold twintich Johre deins du all
Bi‘n godden, krißkatollschen Hären,
Un nu woß oppen ollen Dag
Du Rackerhund noch luttersch wären!”
Hier haben wir die ganze ursprüngliche Situation der hellwegischen Kleinstadt, aber auch die Grundhaltung, aus der hier der Witz entspringt Als westfälischer Mühlenknecht reagiert er mit einem unlogischen Sprung genau wie unser Freund auf die “humores”. Statt eine vernünftige Lösung zu suchen, rennt er auf die am weitesten von der Möglichkeit entfernte zu. Das war auch bei Kortum nicht anders, aus der gleichen Haltung entsprang seine Dichtung “Adams Hochzeitsfeyer”.
Das ist aber nur die eine Seite, die Veranlagung. Eine weitere ergibt sich aus der soziologischen Situation. Der Bewohner der alten preußischen Mark – und nur auf diese, nicht auf Recklinghausen paßt Täppers Gedichtchen – ist im Gegensatz zu den meisten anderen Deutschen seit Jahrhunderten gewöhnt, friedlich mit Andersgläubigen zusammenzuleben. Als sich das protestantische Brandenburg-Preußen und das katholische Pfalz-Neuburg über die Aufteilung der Erbländer ihrer ausgestorbenen clevischen Verwandten einigten, machten sie den Vorbehalt der Duldung aller drei Konfessionen. Man lebte in einer Art Burgfrieden neben- und miteinander. Wie Rudolph Hengstenberg, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts als Sohn des Pastors der kleinen evangelischen Gemeinde nach Bochum kam, in seinen “Lebenserinnerungen” erzählt, hielten die evangelischen Pastores mit ihren katholischen Konfratres äußerlich durchaus Freundschaft. Diese ging sogar so weit, daß sie sich zwar nicht, wie damals unter Geistlichen gleicher Konfession üblich, “Herr Bruder”, wohl aber – und ohne die Komik dieses Verhaltens zu empfinden – “Herr Stiefbruder” anredeten. Als dritter Zug kommt noch die wiederum westfälische Freude am “Äuwen”, an der Neckerei, die freilich durchaus nicht immer taktvoll bleibt hinzu.
Der westfälische Mensch erwacht verhältnismäßig spät. Es fehlen deshalb in unserem Revier alle Witze über “Jöhren”. Im Kinderwitz spielen die Kleinen höchstens eine passive Rolle. Wo “de Jung” auf tritt, benimmt er sich sehr altklug. Selbst der folgende, um 1900 allgemein belachte Witz, ist wahrscheinlich importiert. Im Religionsunterricht fragt der Pastor: “Was mußt du tun, wenn du willst, daß dir deine Sünden vergeben werden?” Die sicher treffende Antwort lautet: “Welche begehen”. Das ist berlinerisch, schlagfertig, keß. Das Kind des Reviers reagiert langsam, es braucht lange, bis es über die heimischen Begriffe hinausgeht. Da ist der Höntroper Junge, ganz bodenständig, der bei einem ersten Besuch in Köln über den Rhein staunt: “Käl! Dat is iäwwer ‘ne graute Biäcke!” Nicht bodenständig, so sozial gebunden er auch erscheint, ist folgender Schulwitz. Der Lehrer fragt: “Wie nennt man den Beruf des Mannes, der den Acker bebaut?” Wie aus der Pistole geschossen kommt die Antwort: “Maurer”. Dieser Witz ist zu pointiert, zu wenig unbeabsichtigter Kurzschluß. Dagegen stammt die folgende Weisheit aus dem Schulaufsatz eines Tertianers des Reviers: “Die Götter waren nach der griechischen Vorstellung wie der Mensch beschaffen. Sie hatten dieselben Tugenden und waren mit den gleichen Lastern behaftet. Sie waren sogar verheiratet”. Endloses Gelächter aber rief der Satz hervor: “Es ist ein Glück, im Unglück einen genossen zu haben”. Dabei hat das artige Kind nur statt eines großen ein kleines g gesetzt.
Sonst machen Kinder im Revier keine Witze. Sie haben nachweislich seit 100 Jahren andere Sorgen. Schon Hengstenberg bezeugt, daß sie nichts von der religiösen Toleranz der Eltern wußten. Auf dem Schulweg verspotteten die evangelischen Kinder die katholischen:
“Katholische Ratten, inne Pfanne gebacken,
kriegt der Deubel alle”.
Dafür revanchierten sich die katholischen Schulkinder mit dem Vers:
“Martin Luther schmiert die Butter
fingerdicke auf die leckre Micke”,
wobei Micke ein süßes Weißbrot bezeichnet. Es gab “Klopp” unter den Jungen, d. h. sie zettelten formgerecht erklärte Raufereien mit den Kindern eines anderen Stadtviertels, meistens einfach einer anderen Straße an, die durchweg mehr phantastischen als seriösen Charakter hatten. Eine verbreitete Unsitte war und ist, soweit die Verkehrsverhältnisse es nicht unterbinden, das Aufstöbern von irgendwelchen Typen, das Nachahmen und Necken von Erwachsenen, oft begreiflicher Weise jenen, die von der Jugend als “natürliche Feinde” empfunden werden, etwa die Schutzleute oder beamtete Hüter der Ordnung. Im übrigen suchen die Kinder ihre spärlichen Spielplätze und vergnügen sich, so gut sie können. Oft ist es leider nicht weit her damit, das Revier ist trotz aller Bemühungen von Behörden, Organisationen, Werksleitungen und Einzelpersönlichkeiten wenig Jugend-freundlich. Das bedingt früh ein gewisses Mißtrauen der Kinder gegenüber den Erwachsenen, das sich noch verstärkt, wenn sie etwa für den Schulweg auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind und die ganze Rücksichtslosigkeit der “Großen” erleben. Aber dennoch opponieren sie eigentlich nicht, sie haben sich daran gewöhnt, die Dinge hinzunehmen. Das aber ist ein ernstes Problem, das gesonderter Erörterung bedarf.
Witze machen für ihre Kinder die Eltern, oft sehr unfreiwillige. Unerschöpflich ist das Gebiet der Entschuldigungszettel: “Mein Sohn konnte gestern nicht in die Schule kommen. Wir mußten das Schwein notschlachten”; “Hiermit bescheinige ich, daß meine Tochter den 3Ojährigen Krieg nicht gemacht hat, weil sie Kopfschmerzen hatte”. Auch die folgende Geschichte entspricht der Mentalität unseres Reviers. Durch schlechte Erfahrungen gewitzigt hat die Lehrerin den Kindern eingeschärft, der Schule fern zu bleiben, wenn in der Familie eine ansteckende Krankheit auftritt. Wir erkennen hier das vordringliche hygienische Problem im schnell wachsenden Revier, wobei die baulichen Voraussetzungen dem Bevölkerungszuwachs nachhinken. Mariechen kommt in die Schule und erzählt treuherzig: “Frollein, wir haben gestern ein Brüderchen gekriegt. Unser Mutter weiß da noch nix von, die is krank. Aber unser Vatter hat gesagt, für Ihnen wär das keine ansteckende Krankheit”.
Viele Witze verraten das für das Revier in seinen früheren Stufen bezeichnende und noch nicht ganz überwundene Zurückbleiben des Bildungsstrebens hinter der vordringlichen Aufgabe, produktiv zu arbeiten. Das ist ein Zug, der für den millionenschweren Großunternehmer ebenso charakteristisch ist wie für den aus irgendwelchen ländlichen Gebieten zugezogenen Hilfsarbeiter. Raffke-Witze gibt es in Berlin, das Revier ist kein Boden dafür. Hier führen solche sozialen Mißstände vielleicht zu vorübergehender Spannung, berühren dann aber nie das Ganze. Bei den betroffenen Bevölkerungsteilen aber wird die Spannung gleich so groß, daß sie sich im sozialen Kampf entlädt.
Tauchen aber gute Witze über reich gewordene Unternehmer auf, so gleichen sie den anderen auf das Haar. Aus der Gründerzeit gibt es Beispiele. Sie beruhen auf der Diskrepanz zwischen dem Bedürfnis, etwas für die Bildung zu tun und den fehlenden Kenntnissen. So wurde von einem großen Pionier der Ruhrwirtschaft erzählt, daß er eines Tages beschloß, sich in Meran zu erholen. Am nächsten Morgen aber rennt er schon zum Postamt: “Nix für mich da?” Der höfliche italienische Beamte fragt: “Bittä? Poste restante?” Der Mann aus Bochum staunt: “Nä, Katholik. Aber wat soll dat hier?” Derselbe Mann steht vor seiner großartigen Villa. Ein Freund kommt vorbei und klopft ihm auf die Schulter: “Na, Willm! Nu heß du‘t iäwwer bolle fien!” “Dat segg wuoll”, lautet die von aller falschen Bescheidenheit freie Antwort, “iäwwer do oüwwer de Döör, do es mi dat noch te nackt. Do sall mi de Moritz Würfel noch de Genitalien van mi im miene Fru ophängen”. Er meinte natürlich die Initialen, die er in der Zinkornamentenfabrik des Moritz Würfel bestellt hatte. Rudolph Hengstenberg hat uns diese Gedichtchen überliefert, sie sind sicher wahr und nicht erfunden.
Diese Treuherzigkeit des unfreiwilligen Witzes bleibt charakteristisch. Aber wir sind bereits an der Grenze dessen, was im Revier an Witz hervorgebracht wurde. Bei vielen erkennen wir den Geist der “Bernardina Bochumensis”, einer von dem Sanitätsrat Dr. Lackmann gegründeten humoristisch-literarischen Akademie, die bei Bernhard Laarmann, dem Altbierbrauer am Neumarkt, tagte. Auf deren Anregung gehen auch die “Lachpillen” Täppers zurück. Im Volke erzählte man andere Witze, die zwar die gleichen Züge der Treuherzigkeit und des typischen logischen Kurzschlusses enthalten, aber die Unzulänglichkeit der Logik besteht dabei darin, daß der Schluß so verblüffend naheliegt, daß er abseitig, wie “Äuwen”, Foppen wirkt. Bernhard Kleff hat unter dem Titel “As noch Biärgamt was” solche Witze zusammengestellt, die diese vergnügliche Unterhaltung in ein Rätsel kleiden, womit der Charakter der Neckerei natürlich noch intensiver wird: “Wann deit se optn Dannenbaum Eikenholt härin? – Wänn se‘t hätt”, “Wat makt Wilm, wänn hä schrömmt? – Krumme Finger”, “Weke Prinz hätt sine Marken nich im Potmanee? – De Prinz von Preußen, de hätt ne Markenbude”. In gleicher Richtung liegen die Rätsel unter dem Stichwort:
“Wat es dat Beste?”, wie “Wat es dat Beste an‘n Strouhhalm? – Daß er nicht nur Loch ist”, Wat es dat Beste anne Schauhniäggel? – daß sie auf dem Kopfe laufen”, “Wat es dat Beste am Diärschflieggel: – Daß der Drescher die Schläge nicht selbst bekommt”.
Das “Äuwen” ruft gelegentlich viel Ärger hervor, denn die Neigung auf anderer Leute Kosten Witze zu machen, ist groß, aber jeder ist äußerst empfindlich, wenn er selbst Opfer solcher Witze wird. Da hat der olle Westhoff, ein Original der Vätertage, von einem befreundeten Klempner eine neue Dachrinne machen lassen. Als er ihn trifft, bemerkt er: “De Dakrenne, de jit makt hiäwwt, is te nix nutz. Et kümmt kien Druopen rut”. Der Meister ist in seiner Berufsehre verletzt, klettert auf das Dach und untersucht die Dachrinne. Erregt kommt er wieder herunter: “De Dakrenne is guott. De makt ink kien Käl in Baukum biätter”. Seelenruhig erklärt der olle Westhoff: Dat heff‘k jo ok nich seggt. Ek heff blouß seggt: de Dakrenne is te nix nutz, et kömmt kien Druopen rut. Et riägent jo nich”.
Die meisten dieser überlieferten Streiche sind primitiv. Es geht um ein paar geklaute Würstchen oder Runden Bier. Man muß dabei sein, um den Witz zu erkennen, es ist wohl jene Mischung der Säfte, speziell des Blutes mit Alkohol dazu erforderlich. Das heißt aber nicht, daß Bochumer Jungen zwischen 18 und 80 nicht mehr bereit wären, eine große Menge Geist und Mühe aufzubringen, um den anderen um eine Runde Bier zu “betuppen”. Wenn man “Witze” macht, so geschieht es mit einer Hartnäckigkeit, die einem Fremden erstaunlich Ist und bei geringerer Kenntnis der Mentalität der Ruhrbevölkerung Kopfschütteln erregen mag. Aber es ist ein typischer Zug, daß auch ausgemachte Dummheiten, Irrtümer oder Unzulänglichkeiten mit geradezu viehischem Ernst durchgehalten werden. Da stellte sich, lange vor dem ersten Weltkriege, ein sonst völlig unbescholtener und ehrsamer Schuhmachermeister höchst persönlich als Kandidat für die Stadtverordnetenwahl auf. Der Griesenbruch war sein Gebiet. Durch zahlreiche verwandtschaftliche Beziehungen brachte er mühelos die erforderlichen Unterschriften für seine Kandidatur zusammen. Er hatte einen einmaligen Wahlschlager, den “Molkenplatz”, wie er trotz aller Begeisterung für Preußens Generalstabschef in seinen Wahlreden und auf eigene Kosten gedruckten Plakaten den so viel benutzten Platz benannte. Der Molkenplatz war zu nichts nutz. Die Anwohner hatten von den Wochen- und Viehmärkten nur den Lärm und den Dreck. Die Osterkirmes vollends war lebensgefährlich, weil sie nur zu Unsittlichkeit und dazu gehörigen Schlägereien führte. Also weg mit dem Molkenplatz! Zur Hälfte wird die Stadt ihn mit Kartoffeln, zur anderen Hälfte mit Kapps bepflanzen lassen. Die Ernte gehört den Anliegern. Und damit ging der Krach los. Wieso sollten nur die Anlieger nutzungsberechtigt sein? Es gab lebhafte Kontroversen über den Kreis der Nutzungsberechtigten an Kartoffeln und Kapps. Der eigentlich strittige Punkt, über den sich die Gemüter erhitzten, war, ob Grundbesitz Voraussetzung für die Beteiligung an der Ernte sein sollte. Darüber wurden Versammlungen abgehalten, bei denen wahrscheinlich mehr vertrunken wurde, als der Platz, wenn man auf den Vorschlag überhaupt hätte eingehen können, in hundert Jahren hervorgebracht hätte. Tatsächlich kriegte der Kandidat bei der Wahl, die immerhin öffentlich war, also einigen Bekennermut verlangte, 61 Stimmen, was freilich nicht reichte.
Charakteristisch für den Humor ist auch das Vorgehen eines Bochumer Kaufmannes anno 1896. Da hatte eine Berliner Firma – man kam nie dahinter, was sie eigentlich verkaufen wollte – eine ganz modern angelegte, groß-zügige Inseratenwerbung gestartet. Vierzehn rage lang wurden die Bochumer dadurch aufgeregt, daß in wechselnder Größe Anzeigen erschienen, die nichts brachten als den Text:
“Als ich noch Prinz war in Arkadien... Demnächst mehr”. Dann veranlaßte ein tüchtiger heimischer Kaufmann, daß unmittelbar unter diesen Liedanfang sein Inserat gesetzt wurde, das lautete: “Da kaufte ich meine Buxkinhosen bei ...” Darunter stand fett gedruckt seine Firma. Sicher geht hier der Humor bis an die Grenze des Tragbaren. Der Jurist findet dabei sicher Anstößiges. Aber der praktische Sinn der Revierbevölkerung und die Logik des Juristen haben sich niemals gedeckt. Daß es bei der Ausnutzung aktueller Anlässe auch zu groben Geschmacklosigkeiten kommt, beweist ebenfalls ein Inserat, dieses Mal von 1900. Ein Zigarrenhändler verkündete: “Größer als die Niederlage des Generals Buller am Tugela-River ist meine Niederlage an Zigarren”. Auch daß die Tragödie des russisch-japanischen Krieges in Bochum ihren Niederschlag in der Gründung einer Karnevals-Gesellschaft “Port Arthur” fand, in der man die Beschießung der Festung durch die Japaner durch kräftiges Aufschlagen der Bierseidel markierte und beschloß, den “Durst” der belagerten Bevölkerung sympathetisch zu stillen, ist kulturgeschichtlich symptomatisch, aber kein Ruhmesblatt.
Nirgendwo hat auch der Serienwitz so große Erfolge wie im Revier. Unzählig waren die Schwiegermutter- und Tunnelwitze, wobei die mannstolle alte Jungfer die Hauptrolle spielt: “Jetzt kommt der längste Tunnel der kaiserlichen Eisenbahn, mein Fräulein. – Oh, ich bin auf alles gefaßt”. Aber wir sind damit wieder an der Grenze des importierten Witzes. Aus Berlin (Nante) kam auch der zwischen 1890 und 1914 am häufigsten abgedruckte Witz vom Besoffenen, der im Straßengraben aufwacht und knurrt: “Drecksbude! Dat regent hier ja durch!” Immerhin paßt er zu den Verhältnissen des Reviers. Doch die Motive wechseln nur. Vor kurzem erlebte ich, wie höchst ernsthafte Männer sich zwei Stunden damit vergnügten, eine solche Witzserie zusammenzustellen:
Wo verkehren die Gärtner? — im Spatenbräu,
Wo verkehren die Metzger? — im Hackerbräu,
Wo verkehren die Zahnärzte? — im Kronenbräu,
Wo verkehren die Viehhändler? — im Thierbräu,
Wo verkehren die Bergleute? — im Bergbräu,
Wo verkehren die Knüppelmusikanten? — im Schlegelbräu,
Wo verkehren die Ärzte? — im Siechenbräu.
Es bleibt die Frage, wie weit die zahlreichen Zuwanderer seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Lage veränderten. Sie waren schließlich in der Überzahl. Aber sie kamen nicht geschlossen an und nicht in chao-tische Zustände. Sie traten eine festgefügte Ordnung und zwar eine durchweg sehr kleinbürgerliche, aber traditionsstolze Bevölkerung, die jedem das Einleben erschwerte, ja unmöglich zu machen geneigt war, der sich nicht anpaßte. Auch die Stanis-Witze haben keine irgendwie ostpreußischen oder schlesischen Züge, denn nicht Stanis macht sie, sondern die Einheimischen. So fügt sich auch der vielleicht beliebteste Witz dieser Gattung zwanglos in das aufgezeigte System. Stanis triumphiert: “Habe ich schön betuppt Eisenbahn. Hab ich genommen Retourbillet und bin ich gelaufen zu Fuß”. Es ist die gleiche Logik, die der brave Invalide einnimmt, als ihn ein Kollektant besucht. Er dreht die Sammelliste in den Händen und ist unschlüssig. Dann meint er: “Usse Direktor van‘n Pütt gifft fiftich Mark. Dann sallen‘t föür mi armen Düwel wuoll twintich daun!” Der überraschte Kollektant lobt den guten Willen, wendet aber vorsichtig ein, daß der Betrag für seine Verhältnisse etwas hoch sei. “Nä wat!” erklärt unser Invalide energisch, “ek heft jo Tiet. Ek sitt de twintich Mark einfach aff”.
Kleinbürgerlich war diese Welt, in die Männer und Frauen aus allen Teilen des Vaterlandes kamen. Das ist insofern wesentlich, als gerade die zahlreichen Ostpreußen kein unbedingt fremdes Element brachten. Es bestehen zahlreiche stammesmäßige Gemeinsamkeiten. Die Freude am logischen Kurzschluß, an der aus Schwerfälligkeit herbeigeführten Pointe, am behaglichen kleinbürgerlichen Leben brachten sie mit. Die Unterschiede zwischen den ostpreußischen Zuwanderern und den westfälischen Eingesessenen waren mehr sozialer als blutmäßiger Natur. Darum paßten sie sich schnell an, gingen oft schon in der zweiten Generation Familienbindungen ein. Während die nationalpolnischen Zuwanderer sich streng abschlossen, ganz unter sich blieben, neben den deutschen eigene konfessionelle Vereine gründeten, schließlich auch die erste Gelegenheit ergriffen, das ihnen immer fremd bleibende Revier wieder zu verlassen, wurden die Ostpreußen eine Bereicherung in jeder Hinsicht. Ihr frischer Tatendrang, ihr fröhlich zupackender Geist brachte eine wohltuende Belebung in der Neigung zur Stagnation, zur Beharrung, die der Entwicklung des Reviers oft schädlich gewesen ist.
Ein paar Witze von politischen Wahlen mögen zeigen, wie eng der Horizont lange blieb. Man freute sich jahrzehntelang über den angeblichen Reichstagswähler, der mit dem Wahlzettel im Umschlag aus der Nische kurz entschlossen wieder vor den Wahlvorstand trat und fragte: “Kriegt man die Briefmarke für den Brief auch hier?” Beliebt war auch der Wahlredner der erklärte: “Wenn wir zusammenhalten, bilden wir eine Macht, gegen die selbst die Götter vergeblich kämpfen”. Noch viel typischer aber bleibt der Berginvalide aus dem Ruhrtal, den das Vertrauen seiner Mitbürger in die Gemeindeverordnetenversammlung berufen hatte. Stolz zieht er am ersten Sitzungstage im sonntagschen Rock zum Rathaus. Ein paar Stunden später kommt er verärgert wieder, hängt den Rock ins Schapp, setzt sieh hinter das “Stripprnaut” und haut wortlos ein. Die Schwiegertochter, die vor Aufregung brennt wird unruhig: “Nu, Vadder, wat was denn loß op‘t Rothus? Vertell doch mol! Wat hefft gitt denn beroaden?” Der Alte schaut auf und knurrt: “Den Düwel ouk! De Kähls kürt jo nix as Haugdütsk. Dat sall‘n Düwel verstoahn!” Beruhigend fährt er dann fort: “Nu, morgen sall`t jo wuoll in`t Blättken stoahn. Dann kannse‘t je liäsen!”
Die kleinbürgerliche Denkweise des Menschen im Revier hat durchaus nicht immer seine Stadt, vielleicht nicht einmal die ehemalige Dorfgemeinde, die zum Stadtteil geworden ist als Mittelpunkt. Er lebt in der engsten Ge-meinschaft in seiner Kolonie, seiner Straße, in der Nachbarschaft. Dazu kommt die Betriebsgemeinschaft in der er durchweg auch nur seine Werkstätte oder seine Abteilung kennt. Als stärkere Bindung bleibt die Kirchengemeinde, vielleicht die einzige umfassendere Gemeinschaft, die der Ruhrbürger bedingungslos als Heimat empfindet. An ihre Stelle können die Partei, der Verein, die Organisation treten. Die Umwelt ist so stark, daß sich der einzelne nicht ohne weiteres als Einzelpersönlichkeit behaupten kann. Deshalb sucht er Anlehnung. Schwer ist es, ihn für Interessen zu gewinnen, die über seinen meist engen Horizont hinausgehen. Das ist in seiner Mentalität bedingt. Er bleibt beschaulich, besinnlich, dabei lebenszugewandt, aber auch mißtrauisch, vorsichtig im ersten Umgang mit anderen, dafür freilich bis zum Leichtsinn zutraulich, wo er glaubt, Vertrauen haben zu dürfen.
So ist auch der Humor des Menschen von der Ruhr. Er ist im Kern und in allen wesentlichen Einzelrügen westfälisch, genauer hellwegisch, also gutmütig, aber zum Spott, genauer zum Foppen geneigt, was umso merkwürdiger ist, als er überempfindlich wird, wenn solche Späße mit ihm .betrieben werden. Dann können Feindschaften entstehen, die ein Leben lang anhalten. Im Sich-Bösesein ist man groß im Revier. Gelegentlich lösen sich solche Spannungen in tatfreudigen Auseinandersetzungen, wie sie seit rund hundert Jahren die Gerichte zum ansehnlichen Teil beanspruchen und dem Ruhrgebiet den Ruf eintrugen, eine lebensgefährliche Gegend zu sein. Das ist es keineswegs. Der normale Ort, an dem jegliche Streitigkeit behoben werden kann, ist die “Theke“. Man “trinkt sich einen“ und noch ein paar, man wird versöhnlich, man schließt Freundschaften Dem Fremden mag es sonderbar erscheinen, aber es gibt keine festeren Freundschaften als die an der Theke geschlossenen. Natürlich ist die Theke auch der Platz großer und kleiner geschäftlicher Abschlüsse, der politischen Debatten, der weltanschaulichen Auseinandersetzungen. Da kann es bei Tanzveranstaltungen sehr leicht vorkommen, daß die Damen solo im Saale sitzen, während die Herren an der Theke den Stand der Aktien oder die Wahlaussichten der einzelnen Kandidaten besprechen.
Aber man Hebt auch die Gemütlichkeit, die in zahllosen Vereinen gepflegt wird. Dabei treibt man das Vergnügen mit der gleichen Konsequenz, mit der man an die Arbeit geht. Der viehische Ernst, mit dem oft die lustigsten Dinge betrieben werden, amüsiert den Fremden, bis er erfaßt, daß hinter seiner Maske sich eine große, allzu leicht aufgerührte Empfindsamkeit verbirgt. Vor allem flüchtet man gern in die Erinnerung an die alte Zeit in der es angeblich so viel gemütlicher war. Man ist durchweg technisch genug geschult, um zu erkennen, daß es damit gar nicht so viel auf sich hat. Aber man scheut die letzte Konsequenz und nimmt lieber eine Scheintradition für die nüchterne Wirklichkeit. Aus der gleichen Haltung schätzt man auch Sprichwörter nicht. Man wählt lieber die “Sagwörter”, bei denen eine groteske Anwendung die Härte der Aussage mildert: “Aller Anfang es schwor! – meinde de Viggelinstrieker. – Do woll he anfangen mit‘m Drinken optehörn”, “Et es allet rnan‘n Oüwergang! – segg de Voß, – do trocken se em‘t Fell öüwer de Uhren”, “drüttein es ne Unglückstall! – sagg de Jung – do foll he met‘n Dutz Eier de Trepp herunner”. Diesen Charakter liebevoller Gemütlichkeit haben auch viele Witze, die den Städter in die altertümlicheren Verhältnisse der halbländlichen Vororte oder gar der Dörfer führen. Da kommt der Herr Schulinspektor von Bochum zur Revision nach Stiepel. Der Tag ist heiß, der hohe Herr ist durstig. Er geht in eine stille Kneipe, trinkt ein Glas Bier, noch eins, es schmeckt immer besser. Beschwingt von dem guten Bier, das er dem Wirt wortreich gelobt hat, beginnt er schließlich die Amtshandlung, die über alles Erwarten gut verläuft. Ein paar Wochen darauf kommt er wieder nach Stiepel, geht in Erinnerung an den Genuß von damals wieder in die gleiche Wirtschaft, bestellt das Glas Bier und trinkt. “Dunderstach Minna!” poltert er los, “den Düwel ouk! He, Här Wirt! Wat gifft git mi dann hier te supen! Dat es jo olt und verduorwen, dat smaket wi Hippenmiege. Ji wellt mi wuoll vergiften!” Der Wirt ist erstaunt: Dat kann`k nich verstoahn. Et es doch van datselwige Fättken, wo ek vüör veir Wiäcken dat Beir ut tappt heff, wat ii so giärn supen hewwet!”
Die kleinbürgerliche Haltung, die wir skizzierten, erfaßt die Bevölkerung gewissermaßen von der breiten Mitte in die Masse. In den oberen Schichten ist diese Art Heimatgefühl am wenigsten ausgeprägt. Die alte soziale Ordnung wurde im Industrialisierungsprozeß zerschlagen. Um 1860 war das Gefüge der Kasten in Bochum beispielsweise noch so dicht, daß nicht einmal im Scherz jemand über den Rand seiner Kaste hinauszuschauen wagte. Dafür gibt wieder Hengstenberg ein treffendes Geschichtchen. Der akademisch gebildete Arzt titulierte – meistens, fast immer unter beachtlicher Altbiereinwirkung – den nur handwerklich gebildeten Chirurgus “Herr Kollege”. Das brachte diesen jedesmal so in Verlegenheit, daß er zunächst die Ehre ehrerbietigst zurückwies, dann aber sich revanchierte, indem er den Doktor “Herr Oberkollege” anredete. Dieses Gefüge zerbrach. Hunderttausende fanden eine neue Heimat im Ruhrgebiet, aber eine neue Ordnung der Stände mit einer starken kulturtragenden Schicht hat sich nicht herausbilden können. Wo sich ein kulturelles Leben entwickelte, wird es von einer gewissen Elite aus allen Ständen getragen. Die Initiative aber ging fast immer von der Behörde aus. Es fehlt dem Revier noch heute ein wirklicher geistiger Mittelpunkt.
Ein typisches Kind der Nachkriegszeit ist “Kumpel Anton”. Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß die Schreibweise für den Jargon, der darin angewandt wird, die starke Verbreitung dieser Geschichtchen zur Folge hatte. Gewiß sind manche Geschichtchen darunter, die im logischen Kurzschluß, in der Pointenlosigkeit, im Verweilen bei der Situationsschilderung und in dem großen Ernst, mit dem das grotesk Unsinnige vertreten wird, an den biederen Schuhmachermeister aus dem Griesenbruch erinnern, der unbedingt Stadtverordneter werden wollte, um den “Molkenplatz” halb mit Kapps und halb mit Kartoffeln zu bepflanzen. Völlig untragbar ist aber die Meinung, die von angesehenen Männern vertreten wurde, das sprachliche Ungeschick der Zuwanderer habe den merkwürdig schlampigen, um die Grammatik so göttlich unbekümmerten Jargon hervorgerufen, den die Kinder neuer Zuwanderer, gleich welchen Standes, schneller lernen als Schriftdeutsch. Es ist keineswegs eine primitive Verständigungsmöglichkeit. Es bestand im Revier keine Notwendigkeit dafür, ‘denn die Zuwanderer aus Ostpreußen oder Schlesien waren ebenso gut Deutsche wie die Westfalen und verstanden sich sehr gut. Die Nationalpolen, um es zu wiederholen, aber bedurften keiner anderen Verständigung als über ihre Dolmetscher. Man sollte sich lieber an den Gemeindeverordneten erinnern, der “Haugdütsk” nicht verstand, und sich aus dem “Blättken” vorlesen lassen mußte, was er in der Gemeindeversammlung beraten hatte. Hier müssen wir den Ursprung des Ruhrjargons suchen. In rein plattdeutschem Sprachgebiet ergab sich der Zwang, in kurzer Zeit zur schriftdeutschen Verständigung überzugehen. Daraus entstand dieses Hochdeutsch mit niederdeutscher Grammatik und teilweise niederdeutschem Wortschatz, der dann um das eine oder andere Wort aus dem Vokabular der Zuwanderer bereichert wurde. Eine ähnliche Misere erlebte unser Sprachgebiet bereits, als in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Schreiber die niederdeutsche Schriftsprache durch die hochdeutsche ersetzten und in mangelnder Beherrschung der hochdeutschen Kanzleisprache zu vielerlei sprachlichen Mischformen kamen. Was sich damals nur in den Kanzleien abspielte, erfaßte seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert weiteste Kreise. Die rotwelschen Ausdrücke, die “Kumpel Anton” und seine Getreuen gebrauchen, sind dem “ungebildeten” Leser im Revier normalerweise fremd.
Wenn wir abschließend einen Blick auf die älteren Verhältnisse, wie sie Dr. Carl Arnold Kortum repräsentiert, werfen, so erkennen wir bald das starke Beharrungsvermögen der hellwegischen Bevölkerung. Mag man für die “Jobsiade” – nur von ihr soll hier die Rede sein – auch literarische Vorbilder aus weit entlegenen Stammesgebieten, sogar aus Spanien gefunden haben, die Eigenart ihres Humors ist doch typisch westfälisch. Charakteristisch ist die Neigung, die Bosheit nicht auf die Spitze zu treiben, jeden tun zu lassen, was er will, um am Ende doch für jede trostlose Situation, in die sich der Held durch seine großen Untugenden bringt, eine tröstliche Lösung zu finden. Diese Lösung aber ist das Unerwartete, das grotesk Unlogische. Gewissermaßen auf die dümmste Weise erfüllen sich alle Prophezeiungen und Erwartungen. Das gewaltige Horn, von dem die Mutter träumte, das mit seinem gewaltigen Schall die Sünder schreckt, Ist gegen alle Voraussicht ein – Nachtwächterhorn. Damit sind wir beim Kern der Betrachtung. Die Satire ist nicht wie in früheren Werken Kortums Selbstzweck, sie führt zu einer versöhnlichen Weltbetrachtung, die auch das Böse nicht als das Letzte, Absolute anerkennt. Die Fehler der Menschen sind nur die eine Hälfte des Spiegels, in dem man die an sich völlig intakte und vollkommene Welt nur verzerrt, unvollkommen erkennt.
“Geld makt nich glücklich, wiel dat wi doch nich so vill krigget dat et daföür langt”, lautet eine hellwegische Abart eines sonst viel strenger klingenden und vor allem anders gemeinten geflügelten Wortes. Das hätte auch Kortum sagen können. Sein Held ist in unsere Zeit übertragen der Flieger des ruhrländischen Witzes, der aus großer Höhe aus der Maschine stürzt und zwischen die Gleise des Güterbahnhofs fällt. Aber es ist nicht so schlimm, er fällt auf eine “Weiche”. Tobe ist in der gleichen Lage wie der Afrikareisende, der zwanzigmal vor Bäume gerast ist, aber das machte nichts, es waren alles Gummibäume. Nur der Grad künstlerischer Gestaltung unterscheidet Kortums Humor von dem solcher Witze. Damit aber ist er ein legitimes Kind des Reviers aus einer Zeit, in der wir noch gar nicht vom Revier sprechen können. Er beweist uns, daß Witz und Humor seit je und bis heute eine mindestens gleiche psychologische Voraussetzung haben. Die Unterschiede ergeben sich nur aus der gewandelten soziologischen Struktur.
Diese Untersuchung konnte nur allgemeine Grundzüge andeuten. Die Verhältnisse sind kompliziert, oft verwirrend. Aber dennoch zeichnen sich deutlich Besonderheiten ab, die für den Menschen in der abseitigen Zechenkolonie ebenso charakteristisch sind wie für den gelehrten Doktor und Oberst der Schützen in irgendeinem Vorort Der eine wie der andere freut sich an dem Quartalslateiner, also dem, der schon au! Quarta sein “Birkenfelder Abitur” machte, wobei Birkenfeld als auffallend kleines Ländchen das Kleinste vom Kleinen bezeichnet. Als dieser lebenstüchtige Mann im Taubenzucht-Verein geehrt wurde, verfiel er in Bescheidenheit. Alle erhoben sich, er aber wehrte verlegen ab: “Deus mores! Deus mores” Auf gut Plattdeutsch heißt das: “Got sitten!” Aber dann bekannte er sich dennoch stolz und begeistert zu dem hohen Ideal des Taubenvaters, und er schloß seine Rede mit dem ebenso frommen, wie wunderschön halbgebildeten Wunsche:
“Deus ordinatus! – Gott befohlen!” Und damit schließen auch wir.
1958 Bochum Ein Heimatbuch
7. Band
Herausgeber
Vereinigung für Heimatkunde e.V.
Druck und Verlag: Schürmann & Klagges