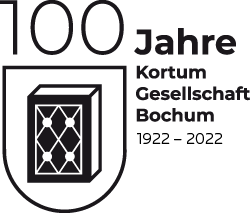Die Geschichte der Ruhrschiffahrt
und ihre Rückwirkung auf Bochum
Dr. Karl Brinkmann
Nach einem Verzeichnis, das der Bergzehntrendant im Jahre 1755 von den Kohlenzechen der Grafschaft Mark anfertigte, waren im damaligen Amt Bochum 20 Gruben in Betrieb. Sie waren sämtlich klein, die größte von ihnen, „Alte Steinkuhle“ hatte 12 Mann Belegschaft. 15 weitere Zechen waren vorhanden, lagen aber still, sechs davon wegen fehlender Absatzmöglichkeiten. Im Gericht Stiepel lagen von 8 vorhandenen Gruben 5 still. Bei dreien hebt der Bericht ausdrücklich hervor: „Alle wegen Mangels des Debits und liegen besonders auf der Friedrich-Sternbergs und Treuen-Zeche bereits von 2 Jahren die Kohlen in Vorrath“, Im Amt Blankenstein arbeiteten 24 Zechen, ebenso viele aber waren stillgelegt. Das Kernproblem war überall der Absatz. Die Straßen waren schlecht für Lastfuhren ungeeignet. Der Transport durch Tragtiere war sehr kostspielig. Er verteuerte ein billiges Massengut wie die Steinkohle derart daß der Abbau unrentabel blieb und sich auf die Menge, die in unmittelbarer Nähe abgesetzt werden konnte, beschränken mußte. Auf das Wirtschaftsleben der Stadt Bochum hatte der Kohlenbergbau überhaupt noch keine fühlbare Rückwirkung. Die Zechen lagen weit südlich der Stadt in den Ruhrbergen. Sie waren auch noch so unbedeutend, daß sie nicht merklich wirtschaftlich auf die Stadt ausstrahlen konnten.
Das Kernproblem war der K o h l e n t r a n s p o r t. Eine Zeit war angebrochen, in der eine erhöhte Produktion durchaus technisch möglich war. Auch die für eine erhöhte Förderung notwendigen Absatzgebiete waren vorhanden. Für die preußischen Lande am Niederrhein, die infolge ihrer natürlichen Verhältnisse notorisch waldarm waren, aber mit oder ohne königliche Hilfe ihre „Manufakturen“ entwickeln wollten, erschien der Kohlenreichtum der Ruhr die gegebene Ergänzung. Solange aber Kohltreiber mit abgemagerten Pferden, die höchstens 4 Zentner mühsam und langsam fortschieppten, das einzige allgemein übliche Verkehrsmittel waren, bestand keine Hoffnung auf eine bessere Versorgung mit billiger Kohle. Selbst Gewinne, die durch verbesserte Abbaumethoden theoretisch möglich schienen, wurden durch die hohen Transportkosten verschlungen.
Im 18. Jahrhundert war eine Wasserstraße der einzig mögliche Verkehrsweg für relativ billige Massentransporte. Und eine Wasserstraße lag gewissermaßen vor den Zechentoren; die Ruhr. Aber sie war ein schwieriger Fluß. Natürliche, politische und künstliche Erschwerungen standen der Schiffahrt entgegen oder machten sie unmöglich. Als geringsten Nachteil mag man damals noch die natürlichen Schwierigkeiten, den stark schwankenden Wasserstand des Flusses empfunden, haben. Das Einzugsgebiet der Ruhr im oberen und mittleren Lauf besteht überwiegend aus wasserundurchlässigen, devonischen Schiefern. Bei Regenfällen läuft das Wasser schnell oberflächlich ab und ruft Hochwasser und Überschwemmung hervor. Die überfluteten Ufer machen dem Schiffer die Orientierung unmöglich, der überschwemmte Leinpfad kann nicht mehr benutzt werden. Die Schiff-fahrt muß ruhen. Im Sommer aber fehlen die Wasserreserven, die Ruhr wird oft so seicht, daß man bequem durchwaten kann. Es fehlt an Fahrwasser für die Schiffahrt. Weniger bedeutend sind winterliche Behinderungen durch Zufrieren oder Treibeis. Ein nicht geringer Nachteil ist auch der durch die gebirgige Struktur des Ruhrtals bedingte, vielfach gewundene Lauf der Ruhr, der die Schiffahrtsstrecke erheblich verlängert. Aber für das 18. Jahrhundert war das kein ernsthaftes Problem, man hatte noch Zeit. Unangenehmer waren die zu erwartenden Pausen in der Schiffahrt, die nur möglich war, wenn 1,2 bis 2 m Fahrrinne gegeben war. Man konnte mit einiger Sicherheit nur in den Monaten November, Dezember, März, April und Mai damit rechnen, daß Kohlenschiffe einigermaßen planmäßig fahren konnten, während der übrigen Monate hing alles von den Zufälligkeiten der Witterung ab.
War man aber bereit, sich mit diesen Schwierigkeiten abzufinden, so war noch nichts gewonnen, denn die für eine Schiffahrt in Aussicht stehende Strecke von rund 70 km des Unterlaufes war durch zahlreiche Wehre ge-sperrt. Die Ruhr mußte bereits tüchtig arbeiten, sie diente als Kraftquelle für viele Mühlen; Mehlmühlen, Oelmühlen und Hammerwerke. Durch Stauung wurde die notwendige Wasserkraft gewonnen. Zu den Mühlenwehren – an der Ruhr sprach man von Schlachten – kamen noch viele Fisch-Schlachten, die zur Erleichterung der Fischerei angelegt worden waren. Sie bildeten künstliche Hindernisse, vor denen die Fische stehen blieben, so daß sie leichter gefangen werden konnten. Wollte man Schiffahrt treiben, so mußte man ent-weder sämtliche Wehre beseitigen. Das hätte die Stillegung sämtlicher Mühlen und Hammerwerke, die lebensnotwendig waren, zur Folge gehabt. Oder man mußte diese künstlichen Hindernisse durch Schleusen umgehen, Niemand, am letzten der Staat, aber war vorerst geneigt die dazu erforderlichen hohen Kosten aufzubringen.
Die letzte, zeitweilig unüberwindliche erscheinende Schwierigkeit aber ergab sich aus der politischen Zerstückelung des unteren Ruhrlaufes. An einer Ruhrregulierung war zuerst die preußische Grafschaft Mark interessiert. Der Schiffahrtsweg aber führte aus der Mark bald auf das Gebiet der reichfürstlichen Abtei Essen, dann in die reichfürstliche Abtei Werden. Beiden aber war der große preußische Nachbar verdächtig, sie be-fürchteten, Souveränitätsrechte einzubüßen, wenn sie einem preußischen Unternehmen auf ihrem Territorium ihre Zustimmung gaben. Ein entschiedener Gegner der Ruhrschiffahrt bis auf preußisches Gebiet aber war auch der Landgraf von Hessen, dem die kleine Herrschaft Broich gegenüber Mülheim gehörte. Mülheim selbst und ein ansehnliches Stück des Unterlaufes gehörte dem Kurfürsten von der Pfalz als Herzog von Berg. Die beiden letzten Landesväter aber hatten sehr materielles Interesse daran, die Mark von der Kohlenschiffahrt auszuschließen. Mülheim war bis tief in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Kohlenstapel- und Handelsplatz ersten Ranges. Unterhalb Mülheim gab es keine Wehre mehr, ungehindert konnte die Schiffahrt bis zum Rhein gehen. Die Mündung der Ruhr allerdings lag wieder auf preußischem Gebiet.
Frühere P l ä n e , d i e R u h r s c h i f f b a r z u m a c h e n, waren im Stadium des ersten Gedankens oder der Planung stecken geblieben. Im einzelnen sind diese Pläne vollständig in den Arbeiten von W. Klische und Valentin Kern wiedergegeben. Bei den großen Schwierigkeiten war es verständlich, daß man einen Ausweg suchte. Zeitweilig hat man sehr ernsthaft daran gedacht, die Emscher als Schiffahrtsstraße auszubauen: Der Siebenjährige Krieg unterbrach alle Entwürfe. Nach dem Kriege aber war für die ausgesogene, verarmte Mark die Erschließung neuer Erwerbsquellen brennend notwendig geworden. Vor der Schiffbarmachung der Ruhr, von der mit Sicherheit ein erhöhter Absatz märkischer Kohlen zu erwarten war, aber schreckte man wegen der hohen Kosten des Schleusenbaues zurück. Unmittelbar nach dem Kriege waren die Finanzen des preußischen Staates auch derart angespannt, daß an solche Aufwendungen nicht zu denken war. So erklärt sich der Versuch des Blankensteiner Lehrers und Gewerken J. G. Müser, der Ruhrkohle über die Lippe einen Absatzweg zu eröffnen. 1765 ließ er die Gahlensche Kohlenstraße bauen, die über die Ruhr hinweg durch das Emscherbruch nach dem kleinen Lippehafen Gahlen führte. So widersinnig es erscheint, daß man über eine mögliche Wasserstraße hinweg durch schwieriges Gelände zu einer nicht allzu leistungsfähigen Wasserstraße fuhr, so unglücklich erwies sich Müsers Plan schon deshalb, weil man damals noch keine Straßen mit fester Schotterdecke bauen konnte. Nur eine solche aber wäre den Anforderungen des Kohlentransportes gewachsen gewesen. So blieb die Gahlensche Kohlenstraße, an die noch heute die Kohlenstraße Bochums erinnert, nicht mehr als eine gezeichnete Fahrbahn mit festgestampfter Erde. Sie war bald von den Pferdehufen und Fuhrwerken aufgerissen. Bei trockenem Wetter versanken die Fahrzeuge im Staub, bei Regenwetter blieben sie im Schlamm stecken, und es half nur wenig, daß man versuchte, die schlimmsten Strecken durch darauf geworfene Reisigbündel oder Strohwische fahrbar zu machen.
Man mußte einen brauchbaren Schiffahrtsweg für die Kohle suchen, und es blieb nur die Ruhr. Die königliche Regierung in Berlin hatte dabei die Kohle freilich zunächst weniger im Sinne als die staatlichen Salzwerke bei Unna. Ihnen hoffte man auf der schiffbaren Ruhr einen günstigen Abfuhrweg und gleichzeitig eine billige Zufahrt für die zur Salzgewinnung erforderlichen Kohlen zu eröffnen. Deshalb war für Berlin die Schiffbarmachung der Ruhr auch nur diskutabel, wenn sie über Herdecke, also über das damalige Kohlenrevier hinaus, bis Langschede ging. Der Salzabsatz schien gesichert, ob aber der rentable Verkauf märkischer Kohle bei der an ein Monopol grenzenden Stellung des Mülheimer Kohlenhandels, der nur in Ruhrort eine beschränkte und abhängig gehaltene Konkurrenz hatte, möglich war, mußte erst erprobt werden.
Preußen konnte sich bei den Verhandlungen mit den Anliegerstaaten auf die Wahlkapitulation Karls VI. vom 12. Oktober 1711 stützen, die bestimmte, daß bei Schiffbarmachung eines Flußes und bei der Schaffung von Wasserstraßen kein Fürst Hindernisse bereiten sollte. Die §§ 5 und 6 der gleichen Kapitulation hoben allerdings diese weise Anordnung teilweise dadurch auf, daß sie die verkehrsfreundliche Freiheit durch die Konzession ein-engten, daß kein Fürst durch Schiffbarmachung in seinen Regalien und Gerechtigkeiten geschmälert werden durfte. Gerade für Broich und Berg aber waren die Kohlenzölle eine recht einträgliche Einnahmequelle. Diese Rechte mußte Preußen respektieren. Dazu kam aber die berechtigte Befürchtung, daß die märkische Kohlenausfuhr die von den zu einem Verkaufsring zusammengeschlossenen M ü l h e i m e r K o h l e n - h ä n d l e r n künstlich in die Höhe getriebenen Kohlenpreise erheblich senken würde. Als die märkische Kohlenschiffahrt aufgenommen wurde, hatten sie, um der Konkurrenz die Spitze abzubiegen, bereits vorsichtshalber die Kohlenpreise gesenkt.
Man ging recht behutsam zu Werke, weil man Kosten scheute. Im Jahre 1770 schloß der König von Preußen, Friedrich der Große, einen Vertrag mit einigen Ruhrortern, deren Wortführer der Zollbeseher van Elsbruch war. Ihnen wurde als einzigen das Recht eingeräumt, auf der Ruhr Kohlen zu verschiffen. Es war allerdings sehr fraglich, ob der König von Preußen berechtigt war, ein solches Monopol zu vergeben, und es kam auch prompt zu Konflikten mit den Mülheimern, denen man im preußischen Ruhrort 1770 Kohlenschiffe beschlagnahmte, die man aber bald wieder frei geben mußte. Kurz vorher hatte auch bereits ein Werdener Tuchfabrikant, H. W. Engels, begonnen, ein Stück der Ruhr zu befahren. Auch er war für den Umschlag seiner Kohlen zum Rhein auf den preußischen Hafen Ruhrort angewiesen. Seinem Geschäftspartner, dem Abt von Werden, zu Ehren nannte er seine Firma nach dem Gründer und Schutzpatron Werdens „St. Ludger und Companie“. Zu Elsbruch und seinem Unternehmen, unterhielt er klugerweise gute Beziehungen, lieh ihnen für den Anfang sogar eines seiner Schiffe. So konnten die Ruhrorter, die sich „Kohlenverschiffungs-Entrepreneurs und Companie“ nannten, 1772 die Koh-lenverschiffung aufnehmen. Auch die Anliegerstaaten hatten mehr oder weniger unter Druck ihre Einwilligung gegeben. Eine zufällige politische Konstellation kam zu Hilfe. Nach dem Aussterben des bayrischen Herr-scherhauses war der pfälzische Kurfürst und Herzog von Berg, Carl Theodor, erbberechtigt. Österreich aber machte seiner Erbfolge Schwierigkeiten, weil ihm die Konzentration der bayrischen und pfälzischen Macht das Gleichgewicht innerhalb des Reiches zu stören schien. Um seinen Anspruch durchzusetzen, brauchte Carl Theodor die Unterstützung des mächtigen Preußen. Der bayrische Thron aber war ihm wichtiger als die Interessen seiner Mülheimer und Ruhrorter Kohlenkaufleute. So tat er zum Entsetzen und gegen untertänigsten Einspruch der bergischen Behörden alles, was geeignet erschien, ihm den preußischen König freundlich gesinnt zu machen. Streng genommen verdankt also das Ruhrland der bayrischen Thronfolge die Möglichkeit der Ruhrschiffahrt und damit die erste Entwicklung zu einem Steinkohlenrevier von überlokaler Bedeutung. Gegenüber Engels war Carl Theodor weniger freundlich. Sein Landesvater konnte ihm nicht helfen. So ging das hoffnungsvoll begonnene Unternehmen „St. Ludger“ nach vier Jahren ein.
Aber auch Elsbruchs Unternehmen sah sich vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. Die Beschränkung auf Kohlenschiffahrt bedeutete eine empfindliche Schmälerung der Tätigkeit und Einnahmen. Vor allem aber versuchten sie sich an einem untauglichen Objekt. N o c h i m m e r s p e r r t e n d i e W e h r e d a s F a h r w a s s e r . Man konnte nur von einer Schlacht zur anderen fahren. Dort hielt man an, legte ein Brett auf ein unterhalb wartendes Schiff und trug die Kohlen in Säcken oder fuhr sie auf Schubkarren herüber. Dieses Spiel wiederholte sich an jedem Wehr. Von Witten bis Ruhrort mußte zuerst 15 Mal, später wenigstens 10 Mal umgeladen werden. Das verursachte hohe Kosten. Und es kam noch schlimmer. Durch das häufige Umladen zerbröckelte die Kohle. Statt der gesuchten und begehrten klaren Stückkohle kam nur ein schmutziger, minderwertiger Kohlenstaub in Ruhrort an, den niemand haben wollte. Dazu kam auch die große Gefahr für die Kohlenträger bei dem halsbrecherischen Balancieren über die Wehre, das nicht ohne Unfälle abging, so daß es schwer wurde, Leute für diese mühsame Arbeit zu finden. Man mußte erkennen, daß es auf diesem Wege nicht weiterging. Die einzige Lösung blieb, die Schiffahrt durch den Bau von Schleusen von Wetter bis Ruhrort von jedem Hindernis zu befreien. Es erschien auch notwendig, die Beschränkung auf Kohlen aufzuheben und die freie Schiffahrt zu gestatten.
Als man das endgültig eingesehen hatte, begann man energisch mit dem A u s b a u d e r S c h 1 e u s e n. Insgesamt mußten von Herdecke bis Mülheim 15 Schleusen gebaut werden. Ein Teil davon lag auf fiskalischem Gebiet und mußte vom Staat getragen werden. Die das Bochumer Gebiet berührenden S c h 1 e u s e n bei Herbede, S t i e p e l , B l a n k e n s t e i n und Clyff (Hattingen) fielen alle darunter. Für die übrigen Bauten schoß die preußische Staatskasse durchweg das Geld vor. Es sollte durch Schiffahrtsabgaben wieder eingebracht werden. Im Jahre 1780 waren alle Schleusen fertig, ungehindert konnte man von Witten, später auch zeitweilig von Herdecke aus bis Ruhrort fahren. Allerdings brachte ungünstiger Wasserstand mit sich, daß erst 1781 das erste Schiff diese Strecke befahren konnte.
Die preußischen Spekulationen auf lohnenden Salztransport erwiesen sich bald als trügerisch. Die Mengen waren zu gering, dafür waren aber die Schleusen oberhalb Witten durch die starke Strömung derart gefährdet, daß sie häufige kostspielige Reparaturen erforderten. Die Schleusengebühren, die sehr niedrig waren, brachten nicht einmal das Gehalt für den Schleusenwärter ein. So ließ man 1803 die Schleusen bei Herdecke, Wetter und Witten eingehen und beschränkte die schiffbare Strecke bis Witten. Die Kohlenverschiffung, der man zunächst nicht ohne Bedenken entgegen gesehen hatte, übertraf bald alle Erwartungen. Wenn jetzt auch andere Güter zugelassen wurden, so blieb Kohle weit vor Holz, Kalk, Steinen und dem bald fast völlig verschwindenden Salz immer das bei weitem am meisten beförderte Gut. Erst sie machte die Schiffahrt lohnend. Auf andere Güter entfielen in der Regel höchstens 10% des benutzten Frachtraumes, wenn sich auch an einzelnen Stellen gewisse Unterschiede ergeben. Zeitweilig spielten auch Bruchsteine aus Steinbrüchen bei Hagen, Volmarstein und Steele eine nicht unerhebliche Rolle. Einige von Spethmann bereits wiedergegebene Zahlen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beleuchteten diese Verhältnisse recht deutlich:
Güterverkehr auf der Ruhr
Jahr Hattinger Schleuse Mülheimer Schleuse
Schiffe mit Schiffe mit
Kohle and. Gütern Kohle and. Gütern
1852 1139 119 5151 431
1855 1489 352 7118 561
1860 678 196 5650 513
1865 432 262 4306 438
1868 381 335 2411 297
1870 312 125 2589 159
1872 303 2 2568 161
1874 50 — 757 128
Vorerst aber brachte die schiffbare Ruhr dem Kohlenbergbau einen gewaltigen Aufschwung. Eine verwaltungstechnische Folge war die Verlegung des ursprünglich In Bochum gegründeten Oberbergamtes, das zuerst nach Schwerte, in größere Nähe der märkischen Salzgewinnung und von dort nach Hagen umgesiedelt war, nach Wetter, in den Mittelpunkt des Kohlenbergbaues. Bereits 1775 war die R u h r s c h i f f a h r t s - k a s s e als vom Staat unabhängige Institution gegründet worden. Aus ihr sollten Baukosten, Amortisationen, Administrationsausgaben, Schleusenunterhaltung und Schiffbarmachungskosten aufgebracht werden.. Am 10. Mai 1781 wurde die „königlich-preußische Wasser- und Uferordnung für den Ruhrstrom in der Grafschaft Mark“ erlassen, die den auch in der Folge erheblichen wasserbautechnischen Problemen gerecht zu werden sucht. Aber die Kosten blieben die große Frage. Zwar war die Ruhrschiffahrtskasse eine Privateinrichtung, deren Einnahmen nicht an den Staat abgeführt wurden und der Verbesserung der Schiffahrt dienen sollten. Unklarheiten aber entstanden, als man sie mit der Ruhrorter Kohlenkasse zusammenlegte. Schon früh wurde der Vorwurf laut, daß die wahren Nutznießer der Ruhrschiffahrt die Duisburg-Ruhrorter Häfen seien. Zweifellos falsch ist der Vorwurf, der später, als die Ruhrschiffahrt verfiel, erhoben wurde, daß der Staat Millionengewinne aus den Schiffahrtsabgaben bezogen habe, ohne etwas zur Förderung der Schiffbarkeit zu tun. Aber das Jahrhundert der Ruhrschiffahrt von 1781 bis 1889 brachte derart grundlegende Veränderungen in den Größen der Schiffsgefäße und Bedingungen der Schiffahrt, daß die 1781 noch recht ansehnlich erscheinende Wasserstraße ohne durchgreifende und nur mit sehr hohen Staatszuschüssen durchführbare Kanalisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts völlig unzulänglich werden mußte.
Einige Förderziffern zeigen deutlich den A u f s c h w u n g , den die Ruhrschiffahrt bald brachte. In der Mark erreichte 1775 die Gesamtförderung 79 885 t, von denen bereits 10 254 t auf die Ruhr gingen. Das waren 13 % 1780 gingen von 99694 t nur 12 %, nämlich 11 884 t zur Ruhr. Es war ein Jahr sehr ungünstiger Wasserstände. 1782 aber wurden von 118 736 t Gesamtförderung 27 632 t, also 23 % auf der Ruhr verfrachtet. Der Anteil der Ruhr stieg 1790 auf 31 %, 1796 auf 33 % und betrug 1800 wiederum 31%, wobei aber berücksichtigt werden muß, daß die Gesamtmenge geförderter Kohlen von 1780 bis 1800 um das Siebenfache stieg. 1804 betrug der Anteil der Ruhr an der Gesamtförderung des Ruhrgebietes 81%, für die Mark allerdings nur 31 %. 1814 wurden aus der Mark 15 %, aus dem Essen-Werdenschen aber 64 % der Gesamtförderung auf der Ruhr abtransportiert. Von 1810 bis 1820 stieg die Gesamtförderung im Oberbergamtsbezirk Dortmund um 19 %, zwischen 1820 und 1830 um 31,8 %. Die Mark und Essen-Werden zusammengenommen erreichten zwischen 1810 und 1820 eine Steigerung um 27,6 %, zwischen 1820 und 1830 dagegen 32,6 %. In Gesamtpreußen betrug der Anteil des Ruhrtransportes an Kohlen 1810 43,5 %, 1820 40,2 % und 1830 41,1 %. Die absoluten Ziffern sind sehr groß, da die Gesamtförderung laufend stieg. Eine wesentliche Verbesserung brachte dann der freie Kohlenhandel nach Holland nach der Gründung des Königreichs Belgien. Bis 1830 war die Ausfuhr von Kohlen nach Holland mit Rücksicht auf die belgischen Kohlenvorkommen durch sehr hohe Zölle behindert, mit der Lösung Belgiens aus dem niederländischen Staatsverband fielen diese Abgaben. Wenn zwischen 1831 und 1841 die Gesamtförderung von 6 Mill. Zentner auf 13,8 Mill. Zentner steigen konnte, so hat die Abfuhr nach Holland einen erheblichen Anteil daran.
Schon jetzt aber ergaben sich Schwierigkeiten. Oft sollen bis zu 40 Schiffe vor den Schleusen gewartet haben. Fiel der Wasserstand, so mußten sie erleichtert werden, was wesentliche Einbußen an Frachteinnahmen zur Folge hatte. Man ordnete an, daß die Schleusen auch an den Sonntagen und Nachts arbeiten mußten. Aber die Schiffahrt blieb ein Wettlauf mit der Zeit. Die Schiffe blieben notwendig klein, die Kohlenmengen aber stiegen gewaltig an. An einem runden Drittel aller Tage des Jahres aber war keine Schiffahrt möglich. Es gab regnerische Jahre, in denen sich die Verhältnisse besserten. So war es 1873, an denen die Ruhr nur 10 Tage unbefahrbar war. Aber das blieb ein seltener Glücksfall. 1845 war die Ruhr an 69 Tagen fest zugefroren, ein Sommer langer Dürre folgte. Amtlich rechnete man mit durchschnittlich 35 Tagen Hochwasser und 24 Tagen Eissperre. Das waren 59 Ruhetage. Hinzu kam aber, daß während mancher Monate der niedrige Wasserstand keine volle Auslastung des Frachtraumes ermöglichte, während die Kosten, die Knechtslöhne, Schiff-fahrtsgebühren, Unterhalt der Zugpferde und auch die Amortisation der Schiffe weiterliefen. Nur der Mangel an anderen, besseren Verkehrswegen also veranlaßte die Fortsetzung und weitere Steigerung der Ruhrschiffahrt. Es blieb nichts übrig, als während der Ruhezeiten die geförderten Kohlen in Magazinen, die sich am Ruhrufer entlangzogen, zu sammeln. Das waren offene, ummauerte oder umzäunte Plätze, von denen aus die Kähne direkt beladen werden konnten. Auch diese Magazine waren aber hochwassergefährdet, und es konnte geschehen, daß die Hochflut die Kohlen abschwemmte. „Die Ruhr hat den Schichtmeister wieder ehrlich gemacht“, pflegten dann die Ruhrschiffer zu spotten, die offenbar kein rechtes Vertrauen zu den Abrechnungen über die Fördermengen hatten. Dazu kam, daß die Kohlen beim Lagern in Wind und Regen an Qualität einbüßten.
Trotz allem aber blieb nur die Möglichkeit, die Ruhrschiffahrt zu steigern, wenn die F ö r d e r u n g s e r - g e b n i s s e stiegen. 1825 gab es 270 Ruhrschiffe. 1831 waren es 377. Dazu gehörten 1508 Schiffer, 6 Lotsen, 300 Austräger. 280 Treiber, also insgesamt 2064 Mann mit rund 300 Pferden. Anfangs der 50er Jahre, als die Ruhrschiffahrt sich ihrem Höhepunkt näherte, gab es über 500 Schiffe mit über 1600 Mann Schiffspersonal, 400 bis 500 Kohlenträgern und etwa 300 Treibern mit etwa 500 Pferden. D e r Z a h l d e r v e r k e h r e n d e n S c h i f f e n a c h ü b e r t r a f d i e R u h r i n m a n c h e n J a h r e n d e n R h e i n. 1837 kamen in Ruhrort 5458 Rheinschiffe und 6885 Ruhrnachen an: 1860 wurde auf der Ruhr eine Gesamtmenge von 892 000 t befördert im gleichen Jahre gingen 1 050 000 t auf dem Rheine. Die Förderungssteigerung des Ruhrgebietes war bis tief in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts geradezu vom Ruhrtransport abhängig. Man nahm alle Schwierigkeiten in Kauf, weil es keinen anderen Weg gab. Das wurde aber anders, als E i s e n b a h n e n ent-standen. Die Köln-Mindener Bahn lag zu weit nördlich, um zunächst wenigstens maßgeblichen Einfluß auf die Ruhrschiffahrt zu gewinnen. Die Bergisch-Märkische Bahn von Dortmund über Bochum, Steele, Essen, Mül-heim nach Duisburg rückte schon bedenklich näher. D e n T o d e s s t o ß a b e r g a b d e r R u h r s c h i f f- a h r t d i e 1 8 6 9 b e g o n n e n e u n d 1 8 7 6 v o l l e n d e t e R u h r t a l b a h n von Witten nach Hattingen und Steele, die unmittelbar das Bergbaugebiet berührte und nicht von Wetter und Wasserständen ab-hängig war. Aber ein zweites kam ebenso gewichtig hinzu. Unaufhaltsam wanderte der Bergbau über die Grenzen der Kreidemergelbedeckung nach Norden ab. Die finanzielle Lage der südlichen Magerkohlenzechen wurde immer schwieriger. Ihre Blütezeit und damit auch die des Bergbaues im Gebiete von Witten und Süden Bochums war die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der zweiten Hälfte verlagerte sich der Schwerpunkt immer weiter von der Ruhr hinweg. Die großen Erbstollenbetriebe, die seit den 20er Jahren allgemein üblich geworden waren, und die die Ruhrschiffahrt erst ermöglicht hatten, waren der Konkurrenz der Tiefbauzechen der nördlicheren Gebiete, die von der Eisenbahn abhingen, nicht mehr gewachsen. Auch der Übergang zum Tiefbau brachte dem Süden keine dauernde Besserung. Die steigende Eisen- und Stahlproduktion hatte eine große Nachfrage nach verkokbarer Kohle zur Folge, während sich die Magerkohle der südlichen Zechen nur schwer verkaufen ließ. Es ging dabei in den südlichen Gegenden des Bergbaues nicht ohne Härten ab. Spezielle Untersuchungen nur können zeigen, wie weit hier wirtschaftliche Notwendigkeit oder risikofeindlicher und divi-dendenhungriger Unternehmeregoismus an den Stillegungen, die mehrfach, wie 1904 in Sprockhövel, revolutionsähnliche Erscheinungen unter der Bevölkerung hervorriefen, beteiligt sind. Für die Ruhrschiffahrt jedenfalls ging die Entwicklung folgerichtig weiter. 1860 hatte sie trotz der Konkurrenz der Eisenbahn mit 862 304 t Fracht ihren absoluten Höhepunkt erreicht. Freilich beförderte die Eisenbahn in diesem Jahre bereits fast die gleiche Menge westfälischer Kohlen. 1850 war ein rundes Fünftel der Förderung des Ruhrgebietes über den Strom verschifft worden. 1875 war es nur mehr knapp ein Zwanzigstel. Es hatte nichts geholfen, daß 1868, viel zu spät, die hohen Ruhrgefälle völlig abgeschafft wurden. 1880 wurden nur noch 23341 t auf der Ruhr verfrachtet gegenüber 344 379 t im Jahre 1870 und 98508 t im Jahre 1875. Einige Jahre noch wurden die Schiffahrtsanlagen mit hohen Zuschüssen unterhalten, aber der Strom verödete mehr und mehr. Die Schleusenwärter hatten gute Tage. 1889 wurden in Mülheim noch 32 Schiffe mit 3392 t Fracht durchgeschleust. Das nächste Jahr brachte eine Naturkatastrophe, ein Hochwasser, das die Fahrtrinne versanden ließ. Es hätte ihrer nicht bedurft, die Ruhrschiffahrt wäre auch so zu Ende gewesen, und es ist nur mehr wie ein Symbol, daß die Natur den letzten Strich unter sie setzte. Die Häfen und Schleusen verfielen nach und nach, die Fahrtrinne versandete weiter, die Magazine wurden abgebrochen, der Leinpfad wurde eingezogen, verfiel und blieb als stiller Spazierweg für naturliebende Wanderer. Noch heute freilich lassen zahlreiche Spuren erkennen, daß einst die Ruhr der Schiffahrt diente. D o c h d a s R u h r t a l i s t s t i l l g e w o r d e n. Geblieben aber ist der bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts buchstäblich richtige Name Ruhrgebiet für den rheinisch-westfälischen Industriebezirk. Längst ist er weit über den ursprünglichen engen Bereich hinausgewachsen, der Name hält einen Zustand fest, der ein Kapitel Geschichte geworden ist.
Welche Bedeutung hatte nun die Ruhrschiffahrt für die damalige Stadt Bochum und ihr heutiges Stadtgebiet? In dem Buche „Dorf und Rittersitz Langendreer in alter Zeit und in der Gegenwart“ stellte Jäkel bereits 1908 fest: „Ja, selbst die Schiffbarmachung der Ruhr brachte keine durchgreifende Besserung. Besonderen Nutzen hatten davon nur die direkt an der Ruhr gelegenen Städte wie Witten, Wetter, Hattingen usw.“ Auch hier, so dürfen wir ergänzen, bleibt die Entwicklung aus verschiedenen Gründen hinter der weiter ruhrabwärts gelegener Gebiete zurück. Vor allem Mülheim hatte bereits eine gewisse Tradition in der Ruhrschiffahrt und im Kohlenhandel, neben ihm trat Ruhrort auf. In manchen Stadtgeschichten märkischer Städte kann man lesen, daß im 18. oder wenigstens 19. Jahrhundert ein Teil der Bevölkerung in der Schiffahrt lohnenden Erwerb fand. Nach einem amtlichen Bericht von 1798 (Meister, Festschrift II) gab es in der Mark in Städten nordwärts der Ruhr überhaupt keinen, in Städten südwärts der Ruhr 4 Schiffer mit einem Knecht. „Auf dem Lande“ wurden im Hammschen und Hördeschen Kreise je ein, im Wetterschen Kreise 6 Schiffer gezählt. Im Vergleich dazu gab es im letztgenannten Kreise 119 Kohlentreiber. Als Schiffer wurden aber auch die Fährleute. Ihre Zahl ist nicht genau bekannt, dürfte aber im großen und ganzen mit der überhaupt genannten übereinstimmen. Jedenfalls bleiben für die Ruhrschiffahrt nur vereinzelte übrig. Das ändert sich in den folgenden Jahrzehnten. 1855 berichtete Jacobi in einer amtlichen Erhebung für den Regierungsbezirk Arnsberg, daß 1819 an hauptgewerblichen Schiffseignern 58 mit 259 Schiffsgemeinschaften vorhanden waren. Leider aber gibt Jacobi nicht an, wie weit er den Zählbezirk zieht. Die Rheinprovinz stand damals noch im Stadium des organisatorischen Aufbaues. Offenbar hat Jacobi die Schiffer des einstigen bergischen Gebietes mitgezählt, denn seine Zahl dürfte ungefähr den gesamten Bestand der Ruhrflotte, der 1825 mit 270 Schiffern angegeben wurde, umfasssen. Zuverlässiger sind die Zahlen, die Jacobi für 1855 gibt. Er zählt 2 Schiffseigner mit 58 Schiffsgemeinschaften. Das wäre ungefähr ein Sechstel der tätigen Ruhrschiffer. Der Schwerpunkt der Schiffahrt lag also weiterhin ruhrabwärts in Mülheim und Ruhrort, die größere Erfahrung und Tradition behauptete sich.
Recht erheblich waren die S c h i f f a h r t s a b g a b e n. Allerdings suchte man durch Staffelungen der Gebühren die am oberen schiffbaren Teil der Ruhr gelegenen Zechen zu begünstigen, indem man die höher gelegenen Schleusen mit geringeren Abgaben bedachte. Für einen Malter Kohle (270 kg) kostete das Durchschleusen bei
Groschen Pfennige
Steinhausen --- 2
Herbede --- 4
Stiepel --- 6
Blankenstein --- 8
Hattingen --- 10
Dahlhausen 1 ---
Insgesamt mußten an den Schleusen bis Kettwig für jeden Malter Kohlen 14 Groschen bezahlt werden, dazu noch 6,5 Stüber Schiffahrtsabgaben, zusammen also 34 Stüber. Die finanzielle Lage war also kaum gebessert, die Transportkosten überstiegen bei längerer Fahrstrecke noch immer den Gestehungspreis der Zeche erheblich. Dazu war der obere Teil der schiffbaren Ruhr verkehrsmäßig weit ungünstiger als die unteren Teile, deren Fahr-wasser auch noch ausreichte, wenn südlich Bochum die Schiffahrt bereits ruhen mußte.
Die Schleuse Herbede bewältigte
1826 145 Schiffe
1827 146 Schiffe
1828 157 Schiffe
1829 136 Schiffe
1830 138 Schiffe.
Zwischen 1826 und 1830 gab es im Jahresdurchschnitt nur 55 Verkehrstage, bei Mülheim war die Zahl wenigstens dreimal größer. Das Verhältnis der in Hattingen und Mülheim durchgeschleusten Schiffe betrug 1852 noch 1:4,6, es sank 1860 auf 1:7, erreichte im Jahre 1863, einem Jahr besonders niedriger Wasserstände nur 1:8,4, stieg dann zwar vorübergehend wieder etwas an, fiel aber 1874 auf 1:19,7. Die Schiffahrt in unserem Gebiet war also besonders anfällig, sie erreichte im Durchschnitt nur ein Achtel oder ein Zehntel der auf der unteren Ruhr beförderten Frachtmengen. Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß bis Mülheim seit den 30er Jahren Dampfschiffe fuhren, die weiter oberhalb nicht genügend Fahrwasser fanden.
Diese Tatsachen dürfen uns aber nicht veranlassen, die Bedeutung der Ruhrschiffahrt für die Entwicklung des Bergbaues im ehemals märkischen Gebiet zu gering zu veranschlagen. Sie war zunächst der einzige Abfuhrweg. D i e Z a h l u n d d i e B e d e u t u n g d e r Z e c h e n s t i e g a u c h i n u n s e r e m s ü d l i c h e n S t a d t g e b i e t r a s c h a n. Vor allem die heutigen Stadtteile Dahlhausen, Weitmar, Stiepel, Brenschede, Querenburg und im beschränkten Umfange Langendreer hatten Gewinn davon. Von den Zechen, die als Folge der besseren Abfuhr entstanden oder raschen Aufschwung nahmen, lagen General, Erbstollen, Hasenwinkel, St. Mathias Erbstollen in Dahlhausen und Weitmar, Vereinigte Urbanus in Langendreer, Glücksburg in Bren-schede, Julius Philipp und Hagensieperbank in Querenburg, Carl Friedrich Erbstollen, Gibraltar Erbstollen und zahlreiche kleinere Zechen, unter ihnen die preußischen Staatszechen Carl Wilhelm Erbstollen, Friedrich und Preußisch-Szepter (später Brockhauser Tiefbau, der „Alte Schacht“ im Friedrichstal) in Stiepel. Sie alle waren Stollenbetriebe und hatten Schienenverbindung zur Ruhr und Magazine. Zuerst hatte man einfach Schleppwege für Karren geschaffen, seit dem 20er Jahren aber ging man zum Bau von Pferdebahnen über. Im heutigen Stadtgebiet führte die B a h n Neuemißgunst vom Stollen Glücksburg zwischen Brenschede und Oberstiepel (L o t t e n t a 1) zur Ruhr. Die B r o c k h a u s e r B a h n begann beim Oberstollen des Carl Friedrich Erbstollens bei Weitmar und zog sich nach Brockhausen zur Niederlage, die nahe der heutigen Kosterbücke lag. Die R a u e n d a h l e r B a h n brachte die Kohle vom St. Mathias Erbstollen zur Ruhr, und eine zweite Bahn führte von den General-Himmelskrone Erbstollen zu den Magazinen am Dahlhauser Ruhrufer. Nebenschienen-wege schufen die Verbindung anderer Zechen mit diesen Hauptbahnen. Gibraltar Erbstollen förderte als einzige Zeche im heutigen Stadtgebiet direkt vom Mundloch des Stollens zur Ruhr.
D i e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e r R u h r s c h i f f e, die im Volksmunde „Aken“ hießen, war beschränkt. Die Ausmaße der Schleusen bestimmten ihre Grenzen. Früh schon werden allerdings Klagen laut, daß diese Grenzen nicht eingehalten werden konnten, weil die Fahrstrecken zwischen den einzelnen, lei-stungsfähigen Schleusen zu wenig Wassertiefe auf wiesen. Die Wasserstauung durch die Wehre und die Erhöhung des Fahrwassers durch die „Kribbenköppe“ reichte nicht aus. Die Länge der Schiffe betrug rund 31,5 m, von denen etwa ein Drittel auf die ausgebauten Vorder- und Hinterteile entfiel. Diese schein-bare Raumverschwendung aber war notwen-dig, weil im Vorder- und Hinterschiff die Wohnung des Schiffers und die Unterkunftsräume der Schiffsknechte lagen. Am Boden waren die Schiffe 4 m, am Bord rund 4,7 m breit. Der Tiefgang dürfte im Durchschnitt 80 cm nicht überschritten haben, konnte allerdings bei günstigen Wasserständen erheblich gesteigert werden, da die meisten Schiffe auch für die Fahrt auf dem Rhein berechnet waren und dabei bis zu 2,6 m Tiefgang belastet werden konnten. Zu Tal fuhren sie mit der Strömung und Segeln. Die Fahrstrecke südlich Bochum war besonders schwierig. Sie war deshalb lotsenpflichtig, aber dennoch kamen hier öfters Unfälle vor. Z u B e r g w u r d e n d i e S c h i f f e v o n L a s t p f e r d e n g e t r e i d e l t. Die geringe Breite des Fahrwassers bedingte besondere Sorgfalt bei der Begegnung in entgegengesetzter Richtung fahrender Schiffe. Das zu Berg fahrende Schiff mußte dann anhalten, bis die Treidelleine auf den Grund sank, so daß das zu Tal fahrende Schiff ungehindert darüber hinweggleiten konnte. Da der Leinpfad nicht gleichmäßig auf einer Seite oder auf beiden Ufern lag, mußte beim Wechseln ein „Überschlag“ gemacht werden. Man mußte die Pferde an Bord nehmen und das Schiff auf das gegenüberliegende Ufer staken. Um Zeit zu sparen, schwamm der Schiffer gern mit den Pferden über den Fluß. Das war aber gefährlich und kostete manchen Schiffsmann das Leben.
Die L a d e f ä h i g k e i t war für unsere Begriffe sehr gering. Aber selbst die kleinste im 19. Jahrhundert noch übliche „Ake“ beförderte mit 1000 Zentnern Last 50 mal so viel wie ein Lastwagen auf der Landstraße. Die Leistungsfähigkeit der „Aken“ steigerte sich auch, als man lernte, statt des ursprünglich verwendeten schweren Eichenholzes das leichtere und billigere Fichtenholz als Baumaterial zu nutzen. Der Eigentiefgang fiel dabei von rund 40 auf 20 cm, erheblicher Frachtraum wurde gewonnen. Aber dennoch blieben die Schiffe zu klein, um auf die Dauer ernsthaft der Eisenbahn Konkurrenz zu bieten. Sie hätten es auch nicht gekonnt, wenn die Wasserstände und Verkehrsverbindungen besser gewesen wären. 1857 gab es unter 336 Ruhrschiffen noch 3 mit nur 1000 Zentnern Ladefähigkeit, 127 konnten zwischen 1000 und 3500 Zentner, 206 über 3500 Zentner laden. Diese größten Schiffe konnten aber normalerweise den oberen schiffbaren Teil der Ruhr nur selten befahren, die Zechen unseres Gebietes blieben auf kleine und mittlere Schiffe angewiesen. Das bedeutet aber, daß die Ruhr die gewaltig gesteigerten Fördermengen der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entstehenden großen Tiefbauzechen auch dann nicht hätte aufnehmen können, wenn diese der Ruhr näher gelegen hätten. Eine wesentliche Steigerung der Ruhrflotte war nicht denkbar, weil die L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e r S c h l e u s e n b e - s c h r ä n k t blieb und schon jetzt den normalen Verkehr trotz Sonntags-, Tag- und Nachtdienstes nur unvollkommen bewältigen konnten. Diese ersten Tiefbauzechen unseres Gebietes suchten deshalb keine Verbindung zur Ruhr mehr. Sie waren vor allem auf den Bedarf der Eisenindustrie ausgerichtet, sie bauten ihre Schienenwege nicht mehr zur Ruhr, sondern zu den Verkokungsanstalten wie um 1850 die Vereinigte Präsident und Vereinigte Engelsburg. Die um oder nach der Jahrhundertwende entstehenden Zechen hatten von Anfang an keine Beziehung mehr zur Ruhrschiffahrt.
Für die alte Stadt Bochum hat die Schiffbarmachung der Ruhr anfangs also gar keine Bedeutung gehabt. Die Grenze des durch sie für den Bergbau aufgeschlossenen Gebietes verlief südlich der städtischen Gemarkung. Wenn 1770 die neugeschaffene Knappschaftskasse und 1816 die märkische Bergschule ihren Sitz in Bochum nahmen, so spielte dabei die Überlieferung der Stadt als Verwaltungssitz wahrscheinlich eine wesentlichere Rolle als die Nähe des Bergbaues. Bochum lag praktisch noch außerhalb des Steinkohlenreviers. Der Bericht über das „Berg-, Hütten und Gewerbewesen des Regierungsbezirkes Arnsberg“ des königlich-preußischen Regierungsrates Ludwig Hermann Wilhelm Jacobi vom Jahre 1857 führt ausdrücklich aus: „Bis vor wenigen Jahren beschränkte sich der eigentlich gewerbliche Charakter des Kreises auf den kleinen südlichen Teil, wo einerseits die mindere Fruchtbarkeit des hügeligen Bodens für die Landwirtschaft weniger günstig ist, andererseits das Gefälle der Ruhr und ihrer Nebenflüsse die Anlegung von Werken, welche eine größere Kraft in Anspruch nehmen, erleichterte, endlich auch die unmittelbare Nachbarschaft anderer industrieller Gegenden gewerbefördernd hinüberwirkte. Selbst der Bergbau war vorzugsweise auf den südlichen Theil des Kreises hingewiesen, indem derselbe gerade dort wegen der daselbst zu Tage gehenden Flöze unter geringeren Schwierigkeiten und Kosten betrieben werden kann, und die kurz nach dem Eintritt in den Kreis schiffbare Ruhr den gewonnenen Produkten die natürlichste und bequemste Abfuhrstraße darbietet. Der nördliche Theil des Kreises, etwa bis zur Wasserscheide der Ruhr, nährte sich vorzugsweise von der Landwirtschaft., und es kamen in demselben nur vereinzelte und unbedeutende gewerbliche Anlagen vor.
Seit den letzten 10 Jahren ist jedoch in diesen Verhältnissen ein großer Umschwung eingetreten; neben der alten Industrie und neben dem alten Bergbau im Süden des Kreises macht sich die neue Industrie und der neue Bergbau in den nördlichen Strichen immer mehr geltend. Insbesondere ist es der Grubenbau, welcher gerade in dem nördlichen Theil des Kreises, dem mächtigen Verkehrszuge der Köln-Mindener Eisenbahn folgend, sich in immer großartigerem Maße entwickelt und eine außerordentliche Anziehungskraft auf den Unternehmungsgeist und die Kapitalien ausübt.“
Jacobi berichtet weiter, daß nicht nur die Ruhr als Schiffahrtsweg unzulänglich war, sondern daß auch die Zechen des Südens mit ihren Erbstollen zurückgeblieben waren. Ihre Arbeitsmethoden waren veraltet, es fehlte an jeder sozialen Fürsorge für die Bergleute und an Kapital. Soweit die Betriebe lebensfähig blieben, wurden sie in enge Beziehungen zu den großen Unternehmen der Industrie gebracht und auf deren Bedürfnisse ausgerichtet. Für die südlichen Teile des heutigen Stadtgebietes bedeutete der Rückgang und die Stillegung der Ruhrschiffahrt also zunächst nur eine neue Orientierung, nichts weniger als eine Katastrophe. Dagegen gingen zahlreiche kleine Betriebe, deren veraltete Organisationsform nicht mehr ausreichte, ein. Auf Bochum selbst hat die Ruhrschiffahrt also nur indirekte Rückwirkungen gehabt Es mag überraschend erscheinen, daß zwischen 1816 und 1867 die Bevölkerungszahl um 7l5 %, zwischen 1867 und 1890 aber nur um 385 % stieg. Aber hierbei muß berücksichtigt werden, daß zwischen 1816 und 1852 der Anstieg nur 273 %, zwischen 1852 und 1867, also in jener Zeit, in der die nicht mehr von der Ruhrschiffahrt abhängigen großen Tiefbauzechen nördlich der alten Bergbaugrenze entstanden, aber 442 % erreichte. Das beweist deutlich, wie relativ gering die fördernde Wirkung der Ruhrschiffahrt gegenüber der seit der Jahrhundertmitte einsetzenden modernen Industrialisierung war. Die Möglichkeiten dieses Wasserweges hatten dem niedrigeren Stand des Stollenbergbaues entsprochen, und diese Möglichkeiten sind ausgenutzt worden. Aber selbst Städte, die unmittelbar an der Ruhr lagen und ihre berg-männische Förderung auf sie ausrichteten, wie Witten und Hattingen konnten erst nach der Entwicklung der modernen Industrie den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichen, und sie nahmen an dem allgemeinen Aufschwung der Städte ebenso Anteil wie Bochum, wenn auch nicht im gleich raschen Tempo. Für diesen relativen Rückgang mag das Erliegen der Ruhrschiffahrt, oder besser das Fehlen einer für Massengüter geeigneten Wasserstraße, denn die alte Ruhr ist seit diesem Jahrhundert als Verkehrsweg nicht mehr diskutabel, e i n e der Ursachen sein. Die B e d e u t u n g d e r R u h r s c h i f f a h r t f ü r u n s e r s ü d l i c h e s S t a d t g e b i e t e r l ä u t e r t a u c h d a s B e i s p i e l S t i e p e l . Von 1810 bis 1867 stieg seine Bevölkerungszahl von 1100 auf 3286. Nach Jacobi waren 1857 auf den sämtlichen von der Ruhr abhängigen Stollenzechen im Gemeindegebiet 468 Mann beschäftigt. Das ist ein erheblicher Anteil der berufstätigen Bevölkerung, wenigstens jeder zweite muß hier beschäftigt gewesen sein. Insgesamt hatten in diesem Jahre die von der Ruhrschiffahrt abhängigen Stollenzechen eine Belegschaft von 1915 Mann, während die neuen Tiefbauzechen 1680 Mann angelegt hatten. Die zweite Zahl ist aber deshalb noch etwas höher anzusetzen, weil Jacobi nur die in der Förderung tätigen Bergleute ansetzt, nicht aber die beim Schachtbau und vorbereitenden Arbeiten beschäftigten Männer. Unproduktiv aber waren in Jacobis Berichtsraum noch Prinz von Preußen, Heinrich Gustav und teilweise Hannibal und Constantin der Große.
Wie sehr selbst ein erfahrener Wirtschaftsfachmann 1857 noch die Situation mißverstehen konnte, beweist eben Jacobi, wenn er prophezeit daß Witten bessere Entwicklungsmöglichkeiten haben würde als Bochum. Er über-schätzt auch damals noch die Bedeutung der schiffbaren Ruhr, die bereits völlig veraltet war, und er erkannte nicht die Vorteile der backenden Kohle der nördlich gelegenen Zechen gegenüber der Magerkohle der Ruhr-zechen. So dürfen wir feststellen, daß Bochum seine Entwicklung zum Industriezentrum und zur Großstadt nicht der Ruhr verdankt vor allem, da das Hauptunternehmen der Eisen- und Stahlindustrie, der Bochumer Verein, von vornherein keine Beziehungen zur Ruhrschiffahrt hatte. Erst mit dem Niedergang des Schiffsverkehrs auf der Ruhr und der Neuorientierung von Bergbau und Industrie sind die Voraussetzungen für die Entwicklung Bochums zur Großstadt gegeben.
Schon 1886, als das Ende der Ruhrschiffahrt offenbar war, hatte man in Witten einen „Verein zur Kanalisierung der Ruhr“ gegründet. Einer seiner regsten Initiatoren war der Sohn des ehemaligen Bochumer Bürgermeister Max Greve, Julius Greve. Unter gewichtigen Vorwürfen gegen die preußische Regierung, die aus der Ruhrschiffahrt ein Geschäft gemacht habe, statt sie im Interesse der Anlieger, vor allem der Zechen zu unterstüt-zen, forderte Greve die durchgreifende Kanalisierung des Ruhrstromes für Schiffe von 1200 t. Ernsthaft wurde dieser Plan erwogen. Als man aber zum Bau eines Kanales schritt, wählte man statt der bereits abseitigen Ruhr-linie die dem Bergbau günstigere Emscherlinie. Dennoch verstummten die Forderungen nach der Schaffung einer modernen Ansprüchen genügenden Wasserstraße im Ruhrtal nicht. Im Anfang des 20. Jahrhunderts trat Oskar Ismer als Sprecher der Interessenten auf. Er ging von dem Gedanken aus, daß der Bergbau des Ruhrtales erlag, weil ein brauchbarer Großschiffahrtsweg fehlte. Keineswegs sind die Kohlenvorräte erschöpft, ihre Förde-rung wurde unrentabel, weil kein billiger Transportweg gegeben war. Mit ihm wäre auch in Witten, Witten-Bommern, Herbede, Blankenstein, Hattingen und im südlichen Bochumer Stadtgebiet ein Bergbau im Großen durchaus denkbar, umso mehr, da dort der Vorteil der geringeren Teufe gegenüber den Großschachtanlagen des Nordens besteht. Temperamentvoll erklärte Ismer, daß ein großes nationales Vermögen brachliegen müsse weil man nicht die Entschlußkraft aufbringe, mit dem Ruhrkanal diese Voraussetzung zu schaffen. Er sprach auch die Überzeugung aus, daß die neuen Ruhrzechen keine Konkurrenz für die nördlichen Zechen bedeuten würden, da die Ruhrkohlen über Ruhrkanal und Rhein überwiegend dem Export in kohlenarme Länder dienen würden. Zweifellos hat gerade dieser Gesichtspunkt in unserer Zeit, die den Zwang zum Kohlenexport als lästige Fessel der eigenen Wirtschaft erlebte, etwas Bestechendes. Aber es bleibt mißlich, in der Wirtschaft Prophet spielen zu wollen, und die ungewöhnlichen Verhältnisse der Nachkriegszeit können kaum ein Maßstab für die endgültige Entwicklung sein.
Deutlich ist die Entwicklung. Greve hatte noch geglaubt, daß sich der Ruhrstrom selbst zu einer brauchbaren Wasserstraße ausbauen ließe, wenn man durch Stauungen, Talsperren und Ausbauten erreiche, daß der Wasserstand gleichmäßig bliebe. Diese Auffassung war schon bald überholt. Und es scheint, daß alle Pläne zur Schiffbarmachung der Ruhr dem gleichen Schicksal verfallen, da die Verkehrsmöglichkeiten für kleinere Transportmengen sich laufend verändern und bessern, die gewaltigen Aufwendungen für ein so umfangreiches und technisch schwieriges Unternehmen wie den Ruhrkanal aber erst dann verantwortbar sind, wenn sehr große Frachtmengen gesichert sind. Dafür aber bietet die gewerbliche Entwicklung des Ruhrtales keinen zuverlässigen Anhalt, und die Spekulation auf eine neue Blüte des stillgelegten Bergbaues auf die Magerkohlen des Ruhrtales ist notwendig fraglich. Überdies aber ist die Ruhr die maßgebliche und lebensnotwendige Quelle der Wasserversorgung des Industriereviers geworden, und die Kanalisierung würde auch hier einen entscheidenden Eingriff bedeuten. So dürfen wir annehmen, daß das Ruhrtal bleibt, was es seit der Jahrhundertwende immer mehr geworden ist: das stille und idyllische Erholungsgebiet der hart arbeitenden Industriebevölkerung.
1954 Bochum Ein Heimatbuch
6. Band
Herausgegeben von der Vereinigung für Heimatkunde E.V.
Druck und Verlag:
Märkische Vereinsdruckerei Schürmann und Klagges – Bochum 1954