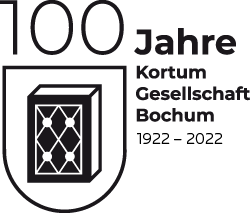Politik zur Geschichte im Stadtbild.
Denkmalpflege in Bochum
Clemens Kreuzer
Geschichte im Stadtbild –
Städte, die sie haben, gelten als reizvoll, abwechslungsreich, interessant, attraktiv, liebenswert. Sie erhalten sie daher, pflegen sie, zeigen sie, werben mit ihnen. Städte, die sie nicht (mehr) oder kaum noch haben, versuchen, sie aus eben diesen Gründen zu reaktivieren, zurückzuholen, neu darzustellen.
Noch nie war das Bemühen deutscher Großstädte so intensiv, ein Stück sichtbarer Stadtgeschichte zurückzugewinnen, wie in den 80er Jahren. Frankfurt läßt seine „Alte Oper“ detailgetreu im Renaissance-Stil wieder erstellen und rekontruiert unterhalb seiner Hochhaus-Skyline eine Altstadt-Häuserzeile am Römerberg. Köln baut seine mittelalterlichen Kirchen wieder auf und präsentiert sich als Stadt der romanische Kirchen. Hannover rekonstruiert das 1652 errichtete, 1943 zerstörte Leibniz-Haus, und Saarbrücken läßt sein Schloß in neuem Glanz erstehen. München hat auf die vor wenigen Jahren verwirklichte Rekonstruktion seines alten Rathausturms auch die des Staatstheaters am Gärtnerplatz folgen lassen, und in Hamburg werden barocke Backstein-Giebelhäuser aufgebaut. Nicht anders verhalten sich die DDR-Städte. Ost-Berlin läßt rechtzeitig zur 700-Jahr-Feier der deutschen Hauptstadt das historische Nicolaiviertel neu erstehen, und Dresden plant nach dem Wiederaufbau des Zwingers, der Hofkirche, der Gemäldegalerie und der berühmten Semper-Oper in ihrer früheren Gestalt nun auch den des Residenzschlosses; die 1945 auf grauenvolle Weise in Schutt und Asche bombardierte Stadt will später auch ihr altes Wahrzeichen, die Frauenkirche, sowie weitere historische Gebäude rekonstruieren und damit ihren Ruhm als “Elbflorenz” neu begründen.
Die Beispiele zeigen, daß es keineswegs die hinter ihrer Zeit zurückgebliebenen, die unmodernen, veralteten Städte sind, die ihrer Geschichte zunehmend Platz im Stadtbild einräumen und es sich etwas kosten lassen. Es sind auch Städte, die über Motive einer vordergründigen Nostalgie erhaben sind; meistens hat sich wohl die Erkenntniss durchgesetzt, daß urbane Lebensqualität mehr ist als die Addition von Wohnwert, Lohnwert und Freizeitwert, und der perfekteste kommunale Service samt bester Infrastruktur noch keine heimatlichen Bindungen schafft. Die entstehen erst, wenn “die gute alte Atmosphäre und damit Lebensqualität begründende Stadtbaukunst” hinzukommen, wenn “Orientierungs- und Identifikationsmöglichkeiten” bestehen. Sie aber bietet in besonderer Weise die Stadtgeschichte.
Alle diese Städte betrieben Politik zur Geschichte im Stadtbild. Die alten, die historischen Städte – genauer: diejenigen, die ihre Geschichte noch nie aus den Augen (und damit aus dem Stadtbild) verloren haben – taten dies immer schon; Stadtgestaltungspolitik war für sie stets auch Bemühen um Geschichte im Stadtbild.
Und Bochum?
- wie stand es hier um die Geschichte im Stadtbild, um das darauf gerichtete politische Bemühen im Werden und
Wandel dieser Revierstadt?
- Welche Aufgaben, Möglichkeiten und Chancen hätte denn eine “Politik zur Geschichte im Stadtbild” unter den
Bedingungen der Industriegroßstadt des Ruhrgebietes heute?
Diesen beiden Fragen, von denen sich die erste eher der Vergangenheit, die zweite der Gegenwart und Zukunft zuwendet, wollen wir nachgehen.
I.
Denkmalschutz in Bochum – von der Romantik bis zur Gegenwart
“Altertümer” – Bochums Denkmalschutzverständnis im 19. Jahrhundert
Als in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, vorbereitet und begleitet durch die Dichter der Romantik, Denkmalschutz in weiten Kreisen, mindestens des Bildungsbürgertums, zu einer “nationalen Aufgabe” wurde, als Karl Friedrich Schinkel in Preußen, wozu auch Bochum gehörte, die Grundlagen des staatlichen Denkmalschutzes schuf und erste Inventarisationen veranlaßte, zeigte Bochum – damals zwar ein agrarisch-klein-bürgerlich geprägtes Provinzstädtchen, aber immerhin auch Mittelpunkt eines flächengroßen Landkreises – wenig Sinn für örtliche Baudenkmäler. Wahrscheinlich hat man die großen nationalen Symbole des damaligen Denkmalenthusiasmus, die Restaurierung des Heidelberger Schlosses und später die Vollendung des Kölner Doms, hier nicht weniger als überall in deutschen Landen beklatscht. Doch in den eigenen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirchen, in den örtlichen Rittersitzen des Bochumer Landadels oder gar in hiesigen Bauern-, Kötter- und Bürgerhäusern vergangener Jahrhunderte denkmalwerte Bauten zu sehen, das fiel niemandem ein, auch nicht den politischen Repräsentanten der Stadt und des Landkreises.
Jedenfalls sind in der 1822 auf Schinkels Betreiben hierzulande zustande gekommenen Denkmäler-Inventrisation, der ersten, die es im rheinisch-westfälischen Raum gab, Baudenkmäler aus Stadt und Landkreis Bochum nicht verzeichnet. Diese 29 Seiten umfassende Liste, mit der die “im hiesigen Regierungsbezirk befindlichen Monumente der Vorzeit” im Jahre 1822 durch den Regierungsbaurat beim Regierungspräsidenten in Arnsberg nach Berlin gemeldet wurden, war durch eine Rundfrage bei den Landräten des Regierungsbezirks zustande gekommen.
Der Landrat von Bochum, dessen Landkreis über das gesamte heutige Stadtgebiet hinaus noch Hattingen sowie – auf die heutigen Verhältnisse bezogen – die südliche Hälfte von Gelsenkirchen und die westlichen Stadtteile Dortmund erfaßte, sah in diesem Gebiet offenbar keinerlei Baudenkmäler, die er für nennenswert hielt. Seine Beteiligung an der Erhebung ergibt sich jedoch daraus, daß – in der Denkmalliste unter “andere Merkwürdigkeiten” eingruppiert – “ der sogenannte Harkenstein” aus Hattingen, “ein Koloß von unreifer GranitArt” sowie “das wahrscheinliche Haupt des Crodo, eines von den alten Niedersachsen verehrten Idols”, aufgeführt sind. Der Horkenstein, der heute in der Grünanlage am Hattinger Omnibusbahnhof liegt, gilt als frühgeschichtlicher Opferstein, und bei dem “Haupt des Crodo” soll es sich um den Kopf einer Götterstatue gehandelt haben, von dem Darpe später berichtet, er sei in das Bonner Museum gelangt. Vom Hauch des Sagenhaften, Unheimlichen und Aufregenden, der diese Objekte aus heidnischer Vorzeit umgab, wurde die Zusammenstellung des Bochumer Teils der “Denkmalliste” offenbar stärker beeinflußt als von seriösen historischen oder kunsthistorischen Nachforschungen. Jedenfalls galt nach damaliger Bochumer Einschätzung weder die eine oder andere der mittelalterlichen Kirchen, von denen es seinerzeit noch rund ein Dutzend im Landkreis gab, noch der eine oder andere von nahezu drei Dutzend Rittersitzen des Kreises als Denkmal von historischem Rang, von jahrhundertealten Bauernhöfen und Bürgerhäusern ganz zu schweigen . Nun war zwar der Denkmalbegriff des 19. Jahrhunderts erheblich enger gefaßt als der heutige, doch werden in der gleichen Erhebung aus der unmittelbaren östlichen Nachbarschaft Bochums immerhin die Dortmunder Reinoldikirche, die Burgruine Volmarstein, die Hohensyburg und die Kirche zu Syburg genannt.
Daß man in Bochum nicht einmal die spätgotische St.-Peter-(spätere Propstei-) Kirche zum Baudenkmal deklarierte, mag an der in den vorausgegangenen Jahrhunderten vorherrschenden und teilweise bis ins beginnende 19. Jahrhundert fortlebenden Einschätzung gelegen haben, nach der die Gotik nicht als eigenständiger Stil der Baukunst, sondern als ein Allerweltsstil mittelalterlicher Kirchenarchitektur galt, von dem sich die Kunstexperten jener Zeiten ebenso naserümpfend distanzierten wie die der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Neogotik. Der Bochumer Mutterkirche verschaffte erst Wilhelm Lübkes 1853 erschienenes Werk “Die mittelalterliche Kunst in Westfalen” den ihr zukommenden kunsthistorischen Rang.
Ob es nun Lübkes Kunsturteil oder jener Bochumer Lokalpatriotismus war, der schon 1810 das Ansinnen der überörtlichen Behörde, den baufällig gewordenen Kirchturm abzureißen, zurückweisen ließ, weil das “Ansehen der Stadt” dadurch sehr leiden würde: Bürgermeister Grewe rechnete in seinem 1861 veröffentlichten Verwaltungsbericht “ die gründliche und stylgerechte, voraussichtlich noch mehrere Jahre dauernde Restauration des Thurmes der kath. Kirche” zu den hervorragenden Bauvorhaben in der Stadt und fügte erläuternd hinzu, dieser Turm sei “in den Uebergangsformen der Gothik erbaut und ein herrlicher Schmuck unserer Stadt und Umgebung”.
Doch über diesen positiven Ansatz hinaus ist in Stadt und Landkreis Bochum der Denkmalschutz im 19. Jahrhundert nicht als kommunale Aufgabe gesehen worden, obwohl der geforderte Schutz der “Alterthümer” mindestens in den Amtsstuben der Behörden nicht unbekannt geblieben sein kann. Schließlich gab es bereits seit den 20er Jahren königliche Erlasse zur Erhaltung historischer Denkmäler, seit 1843 die Institutionalisierung staatlichen Denkmalschutzes im Amt eines preußischen “Konservators der Kunstdenkmäler” in Berlin und seit 1891 in dem des Westfälischen Provinzialkonservators.
Dennoch fielen bedeutende Bochumer Baudenkmäler im Laufe des 19. Jahrhunderts der Spitzhacke zum Opfer. Obwohl eine “Allerhöchste Kabinettsorder” im Jahre 1830 “den Stadtgemeinden die willkürliche Abtragung ihrer Stadtmauern, Tore, Türme, Wälle und anderer zum Verschluß sowohl als zur Verteidigung der Städte bestimmten Anlagen” verbot, hat man in Bochum noch 1842 das Buddenbergtorhaus am Ostausgang der Stadt, das letzte der fünf Bochumer Stadttore, abgebrochen und das zu beiden Seiten noch vorhandene Stück des alten Stadtgrabens zugeschüttet. Das baufällig gewordene, 1696 errichtete Rathaus am Alten Markt mit der auf fünf Pfeilern ruhenden Vorhalle übergaben Bochums Stadtväter 1862 “für 460 Thaler” einem Maurermeister zum Abbruch.
Die 1688 erneuerte Rentei, die Verwaltung des Landesfürsten auf ihrem hiesigen, in die zeit des karolingischen Reichshofes zurückreichenden Besitz, die dann von 1864 bis 1887 als Rathaus diente, erlitt dasselbe Schicksal, nachdem ein neues Rathaus (vor dem jetzigen auf dem heutigen Rathausplatz) bezogen wurde. Dort ließen Bochums Stadtväter zwar ihren Ratssaal von einem Düsseldorfer Historienmaler mit monumentalen, pseudohistorischen Wandgemälden schmücken und sich teilweise sogar selbst darin verewigen, aber die Rentei gaben sie zum Abbruch frei und verhinderten auch 1902 nicht den Abriß jenes Hauses, in dem der Dichter Kortum gelebt hatte und das eines der schönsten alten Bochumer Bürgerhäuser war.
Nun war solch defizitäres Denkmalverständnis allerdings nicht nur den Politikern eigen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fielen innerhalb der heutigen Bochumer Stadtgrenzen vier mittelalterliche Kirchen, weil sie baufällig oder einfach zu klein geworden waren: In Höntrop wurde 1835 das um 1400 gestiftete, am Hellweg gelegene Leprosen-Haus abgebrochen, 1862 auch die dazugehörige Kapelle, die dem Vorgängerbau der heutigen katholischen Kirche Platz machen mußte. Im Jahre 1868 fiel das Langhaus der um 1451 errichteten spätgotischen Wattenscheider Gertrudiskirche für den gegenwärtigen neugotischen Bau. Im Jahre 1895 wurden in Ümmingen das im 14. Jahrhundert entstandene Bauernkirchlein und in Linden die im 15. Jahrhundert errichtete St.-Antonius-Kapelle abgebrochen, obwohl ihre denkmalpflegerische Bedeutung zu dieser Zeit nicht mehr unbekannt gewesen sein kann, denn beide sind in dem zu Anfang der 90er Jahre erstellten Denkmalverzeichnis des westfälischen Provinzialkonservators enthalten. “Es war ein Verhängnis, daß die sonst so konservative Kirche so viele Brücken abbrach, die geeignet waren, die zahlreich ins Ruhrgebiet einziehende fremde Bevölkerung mit der Vergangenheit der einheimischen zu verbinden”, schreibt der Kirchenhistoriker Hegel in seiner Geschichte des Ruhrbistums zu der Serie der Kirchenabbrüche des 19. Jahrhunderts im Ruhrgebiet. Noch 1912 bestand die Absicht, die aus dem 14. Jahrhundert stammende Bartholomäus-Kapelle in Sevinghausen abzubrechen, obwohl diese längst in das Denkmalverzeichnis des Provinzialkonservators aufgenommen war. Erst als “lebhafter Widerstand” der Bevölkerung laut wurde, erklärte sich der zuständige Kirchenvorstand mit Beschluß vom 13. März 1913 damit einverstanden, daß “im Interesse der Denkmalpflege im Industriegebiet ... die alte Bartholomäus-Kapelle zu Sevinghausen erhalten wird”.
Zeigte dieser erste hiesige Erfolg der Denkmalschutzidee, daß diese sich langsam auch ins Ruhrgebiet hinein durchsetzte, so war der Denkmalbegriff, auf den sie sich bezog, doch noch sehr eng. Das Bochumer Ergebnis der Ende des 19. Jahrhunderts vom Westfälischen Provinzialkonservator durchgeführten, zwischen 1906 und 1909 in der vielbändigen Reihe “Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westfalen” mit einem Druckkostenzuschuß der Stadt Bochum veröffentlichten Inventarisation macht dies deutlich. Sie enthält im Gebiet der heutigen Stadt Bochum gerade 15 Baudenkmäler: zwölf historische Kirchen und drei Rittersitze. Dieses dürftige Inventarisationsergebnis resultierte aus einer Definition des Baudenkmals, die noch vom Anfang des 19. Jahrhunderts stammte; der Provinzialkonservator hatte sich nämlich “verhältnismäßig genau an die Empfehlungen des Gutachtens” gehalten, die Schinkel 1815 für Preußen “betr. Die Erhaltung aller Denkmäler und Altertümer unseres Landes” erarbeitete, nur daß der Konservator “vom Barock, den er selber als Entartung empfand, die wichtigsten Objekte widerstrebend miteinbezog. Zudem war die Großstadt der offiziellen Denkmalpflege suspekt. “Die Stadtlandschaft blieb bis auf vereinzelte kirchliche Gebäude außerhalb des Interessenbereichs der Konservatoren, Geschichts- und Altertumsforscher.
Ein Verständnis, das die Denkmalwürdigkeit des Barocks in Frage stellte, den Klassizismus noch nicht für denkmalfähig hielt und den Historismus der Gründerzeit gar nicht erst in Erwägung zog, das zudem vorwiegend “auf Objekte der monarchischen, bürgerlichen, kirchlichen Repräsentationsarchitektur abgestimmt” war und die Belege einer “Geschichte von unten”, etwa Bauernhöfe, Kötterhäuser und technische Denkmäler ignorierte, vermochte in einer Industriestadt des 19. Jahrhunderts naturgemäß nur wenig denkmalwerte Bausubstanz zu erkennen.
Die Vergangenheit zählt nicht – Denkmalschutz der Vorkriegszeit
In den Verwaltungsberichten der Stadt Bochum sucht man bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg vergeblich nach kommunalen Aktivitäten auf dem Gebiet des Denkmalschutzes. Dagegen heißt es im Verwaltungsbericht der Stadt Wattenscheid für die Jahre 1913-1925 immerhin schon: “Zahlreiche Baudenkmäler von hohem Alter sind heute die Sinnbilder früherer Kulturepochen. Der tausendjährige Taufstein in der Propsteikirche und der Barock-Kanzel-Altar in der alten evangelischen Kirche haben z.B. infolge ihres hohen kunsthistorischen Wertes weit über die Grenzen unserer Heimat hinaus dem Namen Wattenscheid Geltung verschafft. Alte Giebelhäuser in verlorenen Gäßchen und die Bauernhöfe in den umliegenden Amtsgemeinden geben der lebenden Generation einen Einblick in das Leben und Weben einer längst versunkenen Zeit”. Doch praktisch scheint man auch nicht sehr weit über derlei Absichtserklärungen hinausgekommen zu sein.
In Bochum war seit der industriellen Gründerzeit eine Haltung vorherrschend, die Franz Peine in den ersten Auflagen seines Buches “So war Bochum” höchst treffend mit den Worten charakterisiert hat: “Bochum, die große Industriestadt im Ruhrgebiet, wahrte seit je den Standpunkt eines selbstbewußten Herrn, der da meint: Was nützt mir eine reiche Vergangenheit? Eine große Zukunft dürfte wichtiger sein!”
Getreu dieser Devise hatte auch der Erwerb einiger alter Rittersitze und Gutshöfe durch die Stadt in den umliegenden Ortschaften seine Motive keineswegs in denkmalpflegrischen Überlegungen. Daß die Stadt 1921 Haus Kemnade, 1922 die Burg Blankenstein, dazu einige alte Gutshöfe in Gerthe, Harpen und Querenburg aufkaufte, war Teil einer expansiven Grundstückspolitik in denjenigen Landgemeinden, die zwar noch selbständig im Umkreis der Stadt lagen, bei denen sich aber der frühere oder spätere Verlust ihrer Selbständigkeit abzeichnete.
Mit Haus Kemnade etwa waren 440 Morgen Land und Forst verbunden. Hier standen beim Erwerb zwar wasserwirtschaftliche Überlegungen im Vordergrund (Schaffung von Wassergewinnungsanlagen im Ruhrtal), aber der “Bochumer Anzeiger” erklärte 1921 – was damals mindestens offiziöse Meinung war – der Erwerb des Rittergutes sei auch “für unsere Eingemeindungspolitik nicht ohne Bedeutung”. Mit Rücksicht auf die zu erwartende Straßenbahnverbindung Stiepel-Blankenstein einerseits und die geplanten Eingemeindungen andererseits erscheine der dortige Landerwerb “durchaus zweckmäßig”, und ein Jahr später kommentierte dieselbe Zeitung den Ankauf der Burg Blankenstein mit dem Satz: “Das Ruhrtal soll für Groß-Bochum werden, was Blankenese für Hamburg ist.” Der Besitz von Burgen hatte selbst im 20. Jahrhundert noch seine imperialistischen Aspekte. Diese mit dem Erwerb der beiden Burgenanlagen verknüpften Hoffnungen erfüllten sich aber nicht; beide liegen noch heute außerhalb der hoheitlichen Grenzen der Stadt.
Waren es somit auch keineswegs Motive des Denkmalschutzes, die Bochum in den 20er Jahren veranlaßten, Burgen und Höfe der Umgebung zu erwerben, so wurde der Kauf immerhin mit denkmalpflegerischen Absichten verbunden. Nach dem Bericht des Westfälischen Provinzialkonservators für die Jahre 1924/25 beabsichtigte die Stadt Bochum jedenfalls, in Haus Kemnade “die beiden Säle im ersten Obergeschoß des Hauptgebäudes mit den beiden schönen Kaminen in ihrem früheren Zustand wieder herzustellen”. Darüber hinaus sollten “auch die dem Verfall nahen Umwehrungsmauern mit den Resten der Ecktürme wieder instandgesetzt werden”. Es geschah jedoch nichts, so daß sich der Provinzialkonservator 1932 nach Besichtigung der Burg veranlaßt sah, die Stadt “zur Wiederherstellung besonders der schönen Kamine” aufzufordern. Gleichzeitig wies er auf “bedenkliche Risse” im Turm der Stiepeler Dorfkirche hin und besprach geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung.
Im Jahre 1934 hatte er die Ruine der Silvester-Kapelle bei Haus Weitmar untersucht und “der Stadtverwaltung, die sich leider nicht des Besitzes vieler Kunstdenkmäler rühmen kann, zur Sicherung des Bestandes empfohlen”. Die Anregung blieb auch erfolglos, als er weitere zwei Jahre später der Stadt die sorgliche Pflege der Kirchenruine bei Haus Weitmar und der Burg Blankenstein erneut anempfohlen” hatte. Denkmalschutz galt eben in Bochum nicht sehr viel.
Dann kam der 2. Weltkrieg, der die wenigen Baudenkmäler des Stadtgebietes zusätzlich dezimierte. Die Altstadt mit dem Weilenbrink, dem Alten Markt und dem Gerberviertel sank in Schutt und Asche. Haus Rechen, Haus Weitmar, Haus Overdyck und der alte Friedhof nahe der “Drehscheibe” – um nur ein paar Baudenkmäler von herausragender Bedeutung zu nennen – wurden zerstört. Was darüber hinaus an alten Bauern- und Kötterhäusern der vorindustriellen Zeit, an Bürgerhäusern der Gründerjahre, auch an interessanter früher Industriearchitektur verlorenging, ist mangels systematischer Fortschreibung der Inventarisation des Provinzialkonservators im einzelnen nicht mehr auszumachen.
Die Erkenntnis, daß der Baudenkmalbegriff mit dem Aufkommen der Denkmalschutzidee nicht ein für allemal verbindlich definiert war und sowohl der normale Zeitablauf, als auch die inhaltliche Ausweitung des Denkmalbegriffs eine ständige Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses zur Folge haben mußte, ist hier ausgeblieben oder ignoriert worden.
Einen Ansatz dazu gab es allerdings einmal in dem 1925 verabschiedeten “Ortsgesetz” der Stadt Bochum, mit dem diese das Preußische Verunstaltungsgesetz von 1907 nahezu zwei Jahrzehnte nach dessen Verabschiedung auf die örtlichen Verhältnisse hin konkretisiert”. Mit dieser Satzung erklärte die Stadt 21 Kirchen und zehn weitere Gebäude zu “Bauwerken von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung”. Daß zu den dort einzeln aufgeführten Sakralbauten neben den schon vom Provinzialkonservator inventarisierten Kirchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit auch Gotteshäuser der Neoromanik, der Neogotik, ja des Jugendstils gehörten, mutet für 1925 auf den ersten Blick erstaunlich weitsichtig an; tatsächlich hat man jedoch fast sämtliche Kirchen der Stadt für geschichtlich oder künstlerisch bedeutsam erklärt. Zu den weiteren zehn öffentlichen Bauten gehörten das Stadt-Theater, die Knappschaftsverwaltung, das Verwaltungsgebäude der Zeche Lothringen die Bergschule und einige andere Schulen.
Insgesamt beschränkte sich die Zusammenstellung auf öffentliche Bauten, so daß selbst manche der bereits in den Inventaren der Jahrhundertwende aufgeführten Objekte – Haus Overdyck zum Beispiel – ungenannt blieben. Die Schutzabsicht war jedoch schon weit gefaßt; nicht nur bauliche Änderungen an den Gebäuden selbst, sondern auch “ in der Umgebung dieser Bauwerke” waren zu versagen, wenn deren visueller Eindruck gefährdet schien. Von praktischer Bedeutung dürfte die örtliche Konkretisierung der preußischen Verunstaltungsgesetzgebung, die übrigens auch in einigen damals noch selbständigen Gemeinden, die heute Bochumer Vororte sind, zu entsprechenden Ortssatzungen führte, nicht gewesen sein.
Daß eine systematische, durch zeichnerische oder fotografische Dokumentation unterstützte Baudenkmal-Inventarisierung unterblieben ist, erweist sich nach den Verlusten des Bombenkrieges, der 42 % der Bausubstanz der Stadt Bochum total zerstörte oder schwer beschädigte und gerade die historische Altstadt und die gründerzeitlichen Baugebiete der Innenstadt fast vollständig ausradierte, als nie wieder aufzuarbeitender, stadtgeschichtlicher Verlust. Bochum hat damit neben einem großen Teil seiner historischen Bausubstanz auch deren bildhafte Reproduzierbarkeit unwiederbringlich verloren.
“Schildbürger im Stadtrat von Bochum”? –
Die Nachkriegsjahrzehnte
Die weitgehende Zerstörung Bochums wurde beim Wiederaufbau als Chance begriffen, die in der Vorkriegszeit an den alten Stadtstrukturen gescheiterte Verkehrssanierung konsequent durchzuziehen. Die großzügige Neuplanung mit solchen Überlegungen zu belasten, wie sie zur gleichen Zeit etwa in Münster oder Nürnberg um die Erhaltung oder Rückgewinnung historischer Stadtstrukturen angestellt wurden, fiel in Bochum offenbar niemandem ein.
Wo der romantische Weilenbrink war, entstand das neue Stadtbad, und im Gewerbeviertel machte sich ein Industriebetrieb breit. Wo Haus Rechen, die zum Heimatmuseum ausgebaute Wasserburg stand, wurden die Kammerspiele errichtet. Wo sich mitten in der City, nahe der Drehscheibe, Reste des Bochumer Freihofes bis 1943 erhalten hatten, wurden moderne Geschäftshäuser gebaut, ebenso an der Grabenstraße. Gewiß war das meiste der historischen Bausubstanz zerstört, aber das waren der Prinzipalmarkt in Münster und die Altstadt von Nürnberg nicht minder, und auch die Bochumer Pauluskirche ist in den alten Umfassungsmauern erneuert worden.
Bei dieser Einstellung zur überlieferten Stadtgestalt verwundert es nicht, daß der Begriff “Denkmalschutz” in der Bochumer Kommunalpolitik der ersten Nachkriegsjahrzehnte gar nicht, die Denkmalpflege erst seit den 50er Jahren auftaucht. In den Verwaltungsberichten der Stadt erscheint sie zwar, doch was dort begrifflich als Beitrag zur Denkmalpflege ausgewiesen wird, ist nur zum Teil darunter zu fassen.
Die Anschaffung einer Sarkophagplatte für das Grab des Intendanten Saladin Schmitt, die Herstellung einer Büste des Heimatforschers Kleff, die Beschaffung des Graf-Engelbert-Brunnens, die Aufstellung eines Mahnmals für die Opfer des 2. Weltkrieges an der Pauluskirche und eines Gedenksteins zum Wiederaufbau der Stadt werden als Denkmalpflege bezeichnet. Dasselbe gilt für Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten an Kriegerdenkmälern, deren ergänzende Beschriftung um Hinweise auf den 2. Weltkrieg und Umsetzung oder Beseitigung oder im Rahmen neuer Straßenführungen. Alles, was irgendwie mit Postamenten jedweder Art zusammenhing, war nach solch naivem Verständnis Denkmalpflege, selbst die wiederholt aufgeführte Grünpflege im Umfeld der Kriegerdenkmäler. Nachdem die Zuschüsse zur Beseitigung der Kriegsschäden an der Propsteikirche als “Denkmalpflege” kategorisiert waren, wurden auch die Zuschüsse zum Neubau der Christuskirche so dargestellt.
An wirklicher Denkmalpflege bleibt nicht viel. Die bedeutendste denkmalpflegerische Maßnahme der Nachkriegszeit war die über mehrere Jahrzehnte hinweg schrittweise vollzogene Wiederherstellung und Restaurierung von Haus Kemnade. Die begann 1954, bezog ab 1958 auch die systematische Restaurierung der Innenräume samt Decken und Kamine mit ein, und 1968 konnte der Landeskonservator berichten: “Trotz relativ kleiner Jahresprogramme ist es gelungen, die weitgehend vernachlässigte Wasserburg in systematischen Arbeitsprogrammen instandzusetzen und den zahlreichen Besuchern des Heimatmuseums und der Gaststätte ein Bild von der bedeutenden frühbarocken Anlage zu vermitteln”. Darüber hinaus wurden ein paarmal Zuschüsse oder Beihilfen für Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten an den Dorfkirchen von Stiepel und Langendreer bereitgestellt, insbesondere auch für die 1963-65 erfolgte Restaurierung der Fresken der Stiepeler Dorfkirche, und an der 1957 durchgeführten Instandsetzung des Bruchsteinförderturms am Bliestollen beteiligte sich die Stadt mit einem Drittel der Kosten. Im Jahre 1959 wurde – wohl mehr aus nostalgischen als denkmalpflegerischen Motiven – die Herstellung einer Nachbildung des im Krieg zerstörten Kuhhirtendenkmals nach dem noch vorhandenen Originalmodell beschlossen, und am 13. Januar 1962 fand die Einweihung der Rekonstruktion statt.
Dann erfolgte 1963 die archäologische Freilegung und Konservierung der Grundmauern der Dorfkirche von Ümmingen, die mit den gleichfalls restaurierten 68 Grabsteinen und Grabplatten des 17.-19. Jahrhunderts zu einer reizvollen historischen Anlage zusammengestellt wurde. Schließlich fand 1968-72 eine durchgreifende Restaurierung des Torturms (Bergfrieds) der Burg Blankenstein mit dem Einbau der Treppe und der Herstellung der oberen Aussichtsplattform statt.
Eine sicher bedeutende denkmalpflegerische Leistung, die insbesondere auf Betreiben des damaligen Museumsdirektors Dr. Peter Leo zurückging, war die Translozierung des ehemaligen Stiepeler Meierhofes – einem Längsdeelenhaus des Hellwegtyps aus der Zeit um 1800 – an seinen gegenwärtigen Standort, wo er die stadthistorische Sammlung in Haus Kemnade als “Bauernhausmuseum” ergänzt. Das Fachwerkhaus wurde vermessen, Stück für Stück in numerierte Einzelteile zerlegt und ab 1971 schrittweise hinter Haus Kemnade wieder aufgerichtet; im Jahre 1973 konnte die Einweihung des Museums erfolgen. Die Umsetzung und damit erreichte Rettung des Meierhofes war das erste größere Denkmalschutz-Engagement im Bochumer Raum, belegt im nachhinein aber auch, daß Translozierung nur selten eine gute denkmalpflegerische Lösung ist und letzter Ausweg sein muß, da der historische Standort per Definitionen zum Baudenkmal gehört. Der in diesem Fall gefundene Platz mag aus praktischen Gründen der Museumsorganisation vernünftig gewählt sein; historisch ist die neu geschaffene Lage des einzelnen Bauernhauses in “Tuchfühlung” mit der repräsentativen Barockanlage unwirklich und verstellt vom Stausee aus den Blick auf das Wasserschloß.
Den zum Teil bemerkenswerten, mit Bezug auf “typische” Geschichtsdenkmäler entwickelten Denkmalpflege-Aktivitäten der 60er Jahre steht eine deutliche Distanz zu solchen Baudenkmälern gegenüber, die der Industriezeit entstammen. Jedenfalls sind nicht die geringsten Anstrengungen erkennbar, von den infolge der Bergbaukrise seit Anfang des Jahrzehnts systematisch und gründlich demontierten bergbaulichen Anlagen das eine oder andere qualitätvolle Industriedenkmal zu erhalten. Im Gegenteil: Als bei der Ruhr-Universität und in der Bevölkerung der Wunsch laut wurde, den Malakowturm der ehemaligen Zeche Julius Philipp in Wiemelhausen, 1875 in Backsteintechnik und Rundbogen-Stil errichtet, nicht mit den übrigen Gebäuden der stillgelegten Zeche abzubrechen, zeigte sich die Stadt in den Verhandlungen über Abbruch oder Erhalt, die sich von 1960 bis 1969 hinzogen, so penetrant uneinsichtig, daß der Malakowturm schließlich “gegen den Willen der Stadtverwaltung Bochum” durch den Kultusminister zum Baudenkmal erklärt wurde.
Einen ähnlichen gravierenden Affront gegen Belange des Denkmalschutzes leistete sich das politische Bochum sogar noch, als man sich schon überall in Europa auf ein “ Europäisches Denkmalschutzjahr” vorbereitete. Daß von Rat und Verwaltung der Stadt noch 1974 erwogen wurde, die Ruine der aus dem 13. oder 14. Jahrhundert stammenden, im romanisch-gotischen Mischstil errichteten, eng mit der Weitmarer Orts- und Gesamtbochumer Reformationsgeschichte verknüpften Silvester-Kapelle abzubrechen, brachte selbst eine so honorige Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine (FAZ) dazu, von den “banausenhaft” handelnden “Schildbürgern im Stadtrat von Bochum” zu berichten. Die seit Anfang der 19. Jahrhunderts sich selbst überlassene und dadurch zur Ruine gewordene Kapelle war wegen drohenden Einsturzes zur Gefahr für spielende Kinder geworden, und insoweit bestand zweifellos Handlungsbedarf. Der Abbruch als schnelle Lösung des Problems und die Antworten der Spitzen der Stadt auf den Proteststurm der Öffentlichkeit, insbesondere aus Kreisen von Kirche, Kunst und Kultur, sprechen für sich. Der damalige Oberbürgermeister äußerte kurz und bündig, er rate “unter allen Umständen ab”, die Schenkung der Kapellenruine anzunehmen. Der damalige Oberstadtdirektor betonte ausdrücklich seinen “Sinn für Denkmalpflege”, doch müsse es sich “um etwas Erhaltenswertes handeln”, und diese Kapellenruine sei “kein erhaltenswürdiger Gegenstand”. Der damalige Fraktionsvorsitzende der Mehrheitsfraktion konnte sich allenfalls dann zu einer Erhaltung verstehen, wenn diese nicht mehr als 50-60 000 DM koste. Wären damals nicht eine aufmerksame Kulturjournalistin, ein engagierter Museumsdirektor, der Kunstverein und eine empörte Öffentlichkeit gewesen, es gäbe die dann schließlich konservierte mittelalterliche Kapellenruine nicht mehr.
Es gäbe dann wohl auch die Ruine von Haus Weitmar nicht mehr, jenes Adelshaus, von dem der Altmeister der Bochumer Geschichte, Prof. Franz Darpe, einst schrieb, es sei “der einzige in alter Würde erhaltene Rittersitz des Amtes”. Erst der 1975/76 unter Federführung des Bochumer Kunstvereins mit einem städtischen Zuschuß realisierten Konservierung der Kapellenruine folgte 1975/78 fast unauffällig die Konservierung des Schloßruine selbst.
Nachträglich wurden die Fragmente von Schloß- und Kapellenruine sowie der zum Teil mehr als 200 Jahre alte Baumbestand des Schloßparks, der sicher selbst ein Denkmal um Sinne des Denkmalschutzgesetzes ist, mit Erläuterungstafeln zu einer reizvollen Anlage ausgestaltet, die man getrost als”historischen Park” bezeichnen kann.
Bewußtseinswandel –
Die Zeit nach dem Denkmalschutzjahr
Schließen sich die ersten drei Nachkriegsjahrzehnte bezüglich dessen, was Denkmalsschutz in Bochum wert ist, nahtlos an die Vorkriegszeit an, so zeichnet sich im letzten Jahrzehnt nach und nach doch langsam ein Sinneswandel ab.
Drei Ursachen haben ihn herbeigeführt:
- Das vom Europäischen Parlament initiierte Denkmalschutzjahr 1975,
die zunehmende Sympathie einer breiten Öffentlichkeit für Belange des Denkmalschutzes,
die Verabschiedung eines Denkmalschutzgesetzes für NRW im Jahre 1980 und die praktischen Auswirkungen seines Vollzuges.
Das Internationale Denkmalschutzjahr wurde von der Bochumer Kommunalpolitik allerdings zunächst einmal gar nicht zur Kenntnis genommen. In dem für die Denkmalpflege zuständigen Kulturausschuß sind weder Niederschriften des Denkmalschutzjahres selbst, noch in denen der sich anschließenden Zeit Aktivitäten erkennbar, mit denen die Idee des Denkmalschutzjahres aufgegriffen und auf die Bochumer Situation hin konkretisiert worden wären.
Die Niederschriften des Kulturausschusses für die Jahre 1975-79 zeigen, daß sich die seltenen Beratungen über Denkmalschutz unverändert in dem gleichen engen Rahmen bewegen und um dieselben Themen kreisen wie in den Jahrzehnten zuvor: Da wird über die Finanzierung der Konservierungsmaßnahmen der Silvester-Kapelle berichtet, da geht es wiederholt um die Ausbesserung, Reinigung und Pflege von Kriegerdenkmälern sowie um die nächsten Schritte bei der Restaurierung von Haus Kemnade einschließlich der Reinigung der 1973 für die Burg angeschafften historischen Wandteppiche. Schließlich wird die 1977/78 durchgeführte Restaurierung der alten Harpener Dorfkirche finanziell unterstützt und ein 1979-81 stufenweise zu realisierendes Restaurierungsprogramm für die Burg Blankenstein beschlossen. Damit sind zwei neue Projekte eingebracht, doch von Initiativen, wie sie aus einer zeitgemäßen Interpretation des Denkmalsbegriffs überfällig waren, ist nicht zu bemerken. Im Gegenteil: Mitte der 70er Jahre wird noch ein technisches Denkmal von hohem Rang, der Wasserhochbehälter an der Castroper Straße, beseitigt. Kurz zuvor hatte man in Wattenscheid den Günnigfelder Malakowturm der Zeche Hannover, einen der bedeutendsten des westfälischen Ruhrgebiets, abgebrochen.
Die zunehmende Sensibilität der Öffentlichkeit für Fragen des Denkmalschutzes, erkennbar in zahlreichen Berichten der Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendungen, hatte auch in der zweiten Hälfte der 70er Jahre noch keine Auswirkungen auf die Bochumer Politik. Von den kommunalpolitischen Programmen, die von den politischen Parteien zur Kommunalwahl 1979 für Bochum herausgegeben wurden, enthielt nur – und auch hier erstmals – das Programm der CDU Forderungen zum Denkmalschutz. Es trat “für die Erhaltung und Pflege jener Gebäude ein, die ein Stück Bochumer Geschichte repräsentieren” und forderte “eine systematischen Ermittlung, Erforschung und Inventarisierung ... erhaltenswerter Bausubstanz”. Der im März 1980 im Plenum des Rates eingebrachte Antrag diese Inhalts und mit dem Ziel, ein “Denkmalkataster” zu erstellen, stieß jedoch auf weitgehende Ablehnung.
Andere Ruhrgebietsstädte hatten eine systematische Inventarisierung denkmal- und erhaltenswerter Bausubstanz schon in den 60er Jahren betrieben und in Buchform veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen belegen bereits ein erstaunlich fortschrittliches Denkmalverständnis. In Mühlheim etwa, einer zwar kleineren, in der Entwicklung der historischen Siedlungsstrukturen mit Bochum jedoch vergleichbaren Revierstadt, hatte eine 1969 abgeschlossene und 1975 publizierte Inventarisation nicht nur Kirchen, Burgen und andere “typischen” Baudenkmäler der vorindustriellen Zeit erfaßt, sondern z.B. auch eine Elementarschule von 1842, ein Postamt von 1860, ein Kriegerdenkmal von 1875, einen Industrieschornstein sowie zwei Ruhrbrücken und zahlreiche Grabdenkmäler des 19. Jahrhunderts, aus dem 20. Jahrhundert u.a. eine Arbeitersiedlung von 1931, eine 1937/43 von Dominikus Böhm geschaffene Taufkapelle und ein Laborhochaus des Max-Planck-Instituts.
In Bochum war man über vergleichsweise kümmerliche Inventarisationsansätze nicht hinausgekommen. Eine 1973 im Kulturausschuß beantragte “Liste aller in Bochum befindlichen Denkmäler” meinte ausschließlich Kriegerdenkmäler. Erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre wurde im Erläuterungsbericht zum Flächenutzungsplan ein Verzeichnis “Künstlerischer und technische Baudenkmal” – aufgeteilt in “denkmalwerte und erhaltenswerte Bauwerke” – vorgelegt, das 45 denkmalwerte und 97 erhaltenswerte Bauwerke, acht technische Denkmäler und zehn Arbeitersiedlungen enthielt.
Daß die inzwischen nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes erarbeitete Liste rund 1100 denkmalwerte und weitere ca. 950 erhaltenswerte Baudenkmale enthält, belegt den erschreckenden Rückstand vorheriger Erfassungsversuche. Mit dem am 1. Juli 1980 in Kraft getretenen Denkmalschutzgesetz war die Inventarisation gesetzliche Verpflichtung geworden. Die politische Verpflichtung zum aktiven Denkmalschutz der Gemeinden bestand allerdings auch vorher schon. Nach der 1950 verabschiedeten NRW-Landesverfassung standen “Denkmale der Kunst, der Geschichte und der Kultur ... unter dem Schutz des Landes, der Gemeinde und der Gemeindeverbände”, doch war “die Einhaltung eines derartigen Verfassungsgebotes kaum erzwingbar”, solange es kein Denkmalschutzgesetz gab. Bei dieser Rechtslage fand aktiver Denkmalschutz nur dort statt, wo eine weitsichtige Kommunalpolitik von seiner Notwendigkeit überzeugt war und das Instrumentarium nutzte, welches das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, das jedoch “auf die Gemeinden als Ortsgesetzgeber angewiesen” ist, schon lange vor Verabschiedung des Denkmalschutzgesetzes bot.
So konnten die Gemeinden “Festsetzungen über den Schutz und die Erhaltung von Bau- und Naturdenkmälern” in ihre Bebauungspläne aufnehmen und “Richtlinien über die Baugestaltung wie die Anpassung an benachbarte historische Bauten” erstellen. Darüber hinaus war sie berechtigt, Satzungen zum Schutz von Baudenkmälern und Denkmalensembles zu erlassen. Ein rechtliches Instrumentarium, das auch vor dem Denkmalschutzgesetz schon den Schutz von Baudenkmälern ermöglichte, war folglich vorhanden, nur “daß die Gemeinden ... ihrerseits dabei mithelfen und mitwirken” mußten, “durch gemeindliches Satzungsrecht diesem Schutz Wirksamkeit zu verleihen”.
In Bochum hat man von diesen Möglichkeiten vor Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes so gut wie keinen Gebrauch gebracht. Es gab lediglich ein paar zaghafte Ansätze: Im Jahre 1977 wurde die Aufstellung von Erhaltungssatzungen für die Havkenscheider Höfe, einer historisch bedeutsamen Straßenbauernschaft zwischen Altenbochum und Laer und 1978 für die zwischen 1880 und 1910 entstandene Zechensiedlung Dreerhöhe in Langendreer beschlossen, zum Erlaß der Satzungen ist es jedoch nie gekommen. Eine 1977 für die Borgholzwiese eingebrachte Erhaltungssatzung kam im Juni 1980 Hals über Kopf zur Verabschiedung im Rat der Stadt, als mit stilentstellenden Umbauten bereits begonnen worden war. In der selben Sitzung wurde auch die Erhaltungssatzung für die Dahlhauser Heide (“Kappeskolonie”), die seit 1975 unter Denkmalschutz stand, beschlossen. Die Restaurierung der “ Kappeskolonie” war im Rahmen eines umfangreichen Sanierungskonzeptes mit erheblicher Landesförderung sicher die denkmalpflegerisch bedeutsamste Maßnahme, die in der zweiten Hälfte der 70er und zu Beginn der 80er Jahre in Bochum stattgefunden hat.
Mit der Realisierung des Denkmalschutzgesetzes tat man sich in Bochum zunächst schwer. Der rathausinterne, von der Ortspresse aufgegriffene Kompetenzstreit zwischen Planungs- und Kulturverwaltung konnte der Sache kaum förderlich sein. Die vielleicht salomonische, aber der Effektivität eher abträgliche Herbeiführung einer komplizierten Trennung zwischen den Zuständigkeiten für Bodendenkmäler, Baudenkmäler und beweglichen Denkmälern einerseits und der unterschiedlichen Zuordnung von Denkmalschutz und Denkmalpflege andererseits war es gleichfalls nicht.
Auch die politischen Entscheidung, ausgerechnet den “Haupt- und Finanzausschuß”, als “kleines Stadtparlament” ohnehin arbeitsmäßig stark befrachtet, zum gesetzlich geforderten Denkmalausschuß zu erklären, erwies sich als wenig sachdienlich. Tatsächlich hat sich der Ausschuß bis zum Ende der Legislaturperiode (1984) nicht als Denkmalausschuß betätigt, wenn man von den publicity-wirksamen Diskussionen um die Hordeler Barbarastuben absieht. Die mit Beginn der neuen Legislaturperiode beschlossene Bestellung des Kulturausschusses zum Denkmalausschuß, die danach erfolgte Berufung “sachverständiger Bürger” und die im Sommer 1985 durchgeführte Zusammenlegung von Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Verwaltung haben dann schließlich klare Verhältnisse geschaffen.
Immerhin vermochte die gesetzesgemäß neu installierte “Untere Denkmalbehörde” 1985 eine Liste der nach ihrer Auffassung denkmalwerten Gebäude in den parlamentarischen Entscheidungsprozeß einzubringen. Im Zuge einer systematischen Begehung de Stadt waren rund 2100 Objekte aufgenommen worden, deren Bewertung ergeben hatte, daß 1143 von ihnen Denkmaleigenschaft zukommt, währen die übrigen zwar nicht Baudenkmäler im Sinne der strengeren Anforderungen des Gesetzes sind, aber nach Qualität und Bedeutung als “erhaltungs-würdige Bauobjekte” gelten dürfen. Von den 1143 denkmalwerten Objekten sind 977 Wohn- und Geschäftshäuser, 106 öffentliche Bauwerke, Kirchen, Verwaltungsgebäude etc., 58 technische Bauwerke und zwei bewegliche Denkmäler. Bei diesen zahlen muß jedoch bedacht werden, daß bei einigen der aufgenommenen Arbeitersiedlungen die Gesamtheit der Siedlung als Baudenkmal gilt, bei anderen dagegen jedes Siedlungshaus einzeln aufgenommen wurde. Die denkmalwerten Wohn- und Geschäftshäuser machen zwei Prozent der in Bochum vorhandenen Häuser dieses Typs aus. Das ist nicht viel. In München beispielsweise sind acht Prozent der Gebäude auch Baudenkmäler, in Wuppertal zehn Prozent. Das Verfahren der Unterschutzstellung war bei redaktionellem Abschluß diesen Beitrages (August 1985) noch im Gang; der Entwurf der Denkmalliste hatte den jeweils zuständigen Bezirksvertretungen zur Beratung vorgelegen, während die Beratung und Beschlußfassung im Denkmalausschuß (Kulturausschuß) noch ausstand.
In der Bochumer Bevölkerung hat die journalistische Begleitung der Inventarisationsvorgänge und die Beratung der Denkmalliste in der örtlichen Presse das Interesse am Denkmalschutz weiter stimuliert. Der Bochumer Bürger erkannte zunehmend, daß er keineswegs in einer “geschichtslosen” Stadt wohnt und daß auch eine Industriegroßstadt ihre architektonischen und historischen Reize hat. Das zunehmende bürgerschaftliche Interesse an der Erhaltung historischer Bausubstanz förderte wiederum die Bereitschaft der Kommunalpolitik, auf Belange des Denkmalschutzes einzugehen, zumal sie bei einigen Absichten, die den Denkmalschutz nicht hinreichend berücksichtigten deutlich zurückstecken mußte.
- Als 1981 die Gefahr bestand, daß der Bochumer Stadtpark, der als frühe gartenhistorische Anlage denkmalwert
ist, durch einen monumentalen Hotelbau in seiner Fläche reduziert und in seiner visuellen Wirkung beeinträchtigt würde, dieser zudem auch die nahe, im Jugendstil errichtete Luther-Kirche optisch zu “erdrücken” drohte, war der Protest der Bevölkerung so stark, daß das Projekt scheiterte.
Als wenig später das Bochumer Rathaus, im Dehio als “eindrucksvolles Beispiel eines frühen modernen
Verwaltungshaus” herausgestellt, einen Erdgeschoßumbau für Einzelhandelszwecke mit stilwidrigen RundBogenmarkisen und zusätzlichen Fassadenöffnungen erfahren sollte, erzwang die sensibilisierte Öffentlichkeit einen vertretbaren Kompromiß.
Als 1984 in Kirchharpen das Freizeitbad “El Dorado” entstehen sollte und seine ursprünglich geplante
Zuwegung den Bestand des 1831/34 erbauten Pastorats der Harpener Dorfkirche gefährdete, gelang es durch massiven Druck der am Denkmalschutz interessierten Kreise, die Planung so zu beeinflussen, daß das historische Gebäude erhalten bleiben konnte.
Als eine einflußreiche Einzelhandelskette im selben Jahr das Lindener Tusculum, ein im Stil der bergischen
Bürgerhäuser errichtetes, in seiner Architektur in Bochum einmaliges, als ehemaliger Wohnsitz des durch seine plattdeutschen Erzählungen in ganz Westfalen bekannten Arztes Dr. Ferdinand Krüger auch ortsgeschichtlich bedeutendes Haus, einem Supermarkt opfern wollte, wurde der Abbruch durch nachhaltige Bürgerproteste und umfangreiche Unterschriftsaktionen vereitelt.
Neben der breiten bürgerschaftlichen Zustimmung zum Denkmalschutz spielte wohl auch eine Rolle, daß die Bochumer Mehrheitsfraktion den aus ihren Reihen hervorgegangenen Städtebauminister, zuständig für den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes und in dieser Hinsicht erfreulich engagiert, nicht gerade in seiner Heimatstadt desavouieren wollte. Schließlich machte der schon in den 70er Jahren zunehmend vollzogene städtebauliche Flächensanierung hin zu einer vorsichtigen, objektbezogenen “erhaltenden Erneuerung” auch aufgeschlossen für Denkmalschutzanliegen. Jedenfalls versuchte Bochums Kommunalpolitik seit Anfang der 80er Jahre, Pluspunkte in Sachen Denkmalschutz, der noch wenige Jahre zuvor als nostalgische Marotte nachsichtig belächelt worden war, zu sammeln. Als etwa 1980 die “Mausefalle”, ein altes Fachwerk-Gasthaus in Munscheid, abgebrochen werden solle, verfügte der Rat der Stadt zunächst eine Veränderungssperre, um die Erhaltungsmöglichkeiten zu überprüfen, und im Juni 1980 verabschiedete er angesichts des drohenden stilwidrigen Umbaus der Bergarbeitersiedlung Borgholzwiese blitzschnell eine Erhaltungssatzung. Ab 1981 engagierte er sich für die Restaurierung des Wasserhochbehälters in Weitmar, und der Hauptausschuß bemühte sich 1983/84 wiederholt um die Erhaltung der Hordeler Barbarastuben, einem Fachwerk-Gasthaus in einem Kotten des frühen 19. Jahrhunderts, das wegen akuter Einsturzgefahr geräumt werden mußte und daraufhin abgebrochen werden sollte. In Wattenscheid wandte sich die Bezirksvertretung 1985 gegen den Abbruch des ehemaligen Schlachthofgebäudes mit dem dazugehörigen früheren Direktorenwohnhaus, einem Ensemble der Jahrhundert-wende in eigenwilliger Backsteinarchitektur. Die Beispielreihe ließe sich fortsetzen.
Doch die Verweigerung von Abbruchgenehmigungen allein ist noch kein Denkmalschutz; eine Politik, die sich lediglich in Abbruchverboten und verbalen Erhaltungsdeklarationen äußert, ist im Tiefsten sogar unglaubwürdig, denn sie erweckt den Anschein gefährdete Baudenkmäler erhalten zu wollen, während sie diese in Wirklichkeit einem langen, häßlichen Verfall preisgibt, an dessen Ende sich dann leichter sagen läßt: “Da war ja nun wirklich nichts mehr zu machen...”
Auch Denkmalschutzpolitik kommt nicht ohne Geld aus. Gewiß kann es dabei nicht um die Pflege von Baudenkmälern auf Kosten des Stadtsäckels gehen. Doch der Besitzer eines Gebäudes sollte Instandhaltungs-mehrkosten, die eine Folge der Gebundenheit an einen besonderen Baustil oder an außergewöhnliche Her-stellungstechniken sind, nicht allein tragen müssen. In der mit Bochum nach Größe, Entwicklung und Stadtstrukturen durchaus vergleichbaren Stadt Wuppertal werden seit langem jährlich nicht unerhebliche Beträge für Zuschüsse zu denkmalpflegerischen Maßnahmen der privaten Denkmalbesitzer etatisiert, für 1985 waren es z.B. über eine halbe Million DM. Dagegen waren in Bochum Etatmittel für die Denkmalpflege bisher auf wenige, durchweg stadteigene Restaurierungsprojekte (Kemnade, Blankenstein) und dabei auf die Mindesthöhe beschränkt, die andere öffentlich-rechtliche Zuschußgeber zur Voraussetzung ihrer Mitfinanzierung gemacht haben.
Bochums Politiker müssen den Beweis erst noch antreten, daß sie den Denkmalschutz wirklich ernst nehmen und nicht nur für den Ausdruck einer Nostalgiewelle halten, auf der sie gern mitschwimmen, solange sie trägt und nichts kostet.
II.
Aufgaben, Möglichkeiten und Chancen einer Politik zur Geschichte im Bochumer Stadtbild
Baudenkmäler, da fallen einem spontan romanische oder gotische Kathedralen, gewaltige Burgen und großartige Renaissance-Schlösser, mächtige Kaiserpfalzen und mittelalterliche Altstadtgassen ein. Doch wer würde derlei schon in einer Ruhrgebietsgroßstadt suchen, zumal, wenn diese historisch nie zu den Zentren politischer Macht oder kultureller Blüte gehört hat.
Verständigt man sich aber darauf, daß Geschichte nicht nur die Historie der Herrscherhäuser und der “großen Männer”, sondern ebenso die der “kleinen Leute” ist, daß sie nicht nur in Kriegen, Aufständen, Revolutionen und ähnlichen Extremsituationen besteht, sondern auch in der Normalität des menschlichen Alltags, daß sie sich nicht nur in technischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Spitzenleistungen darstellt, sondern ebenso in den soliden Ergebnisse landläufiger Arbeit, dann kann eine solche Stadt gerade wegen de Normalität ihrer geschichtlichen Vergangenheit historisch hochinteressant sein. Wenn aber der Alltag vergangener Perioden “bemerkenswerte” Geschichte ist, dann sind auch die Zeugen solchen geschichtlichen Alltags erhaltenswerte Bausubstanz, dann sind sie “bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse”, wie das Denkmalschutzgesetz des Landes NRW den Denkmalbegriff umschreibt.
Untersucht man die Bausubstanz der Industriestädte des Ruhrgebiets aus dieser Perspektive, dann ergibt sich plötzlich ein erstaunliches Volumen an Baudenkmälern. Bochum, nach dem Urteil der gängigen Kunstführer von geradezu spartanischer Ärmlichkeit an Denkmälern der Kunst und der Geschichte, vermag plötzlich mühelos an die elfhundert nachzuweisen.
Wir wollen keine detaillierte Übersicht über diese Bestände bringen, zumal der Prozeß ihrer Feststellung noch nicht abgeschlossen ist, aber doch auf einige Gruppen von Baudenkmälern hinweisen, die für Bochum typisch sind. Dabei geht es uns auch um örtliche Akzentsetzungen zum Denkmalschutz. Da der Denkmalbegriff im Gesetz notwendigerweise abstrakt formuliert, das Denkmal ein “unbestimmter Rechtsbegriff” ist, muß “die Entscheidung über Art und Umfang des kommunalen Denkmalschutzes auch insoweit eine politische Entscheidung” sein, “als in ihr die Vorstellungen einer Gemeinde über das äußere Bild und die Identität der Stadt ihren Niederschlag finden”. Dazu möchte dieser Beitrag Anstöße geben.
Im übrigen wird eine “Politik zur Geschichte im Stadtbild” auch über die “offiziellen” Baudenkmäler hinaus zu prüfen haben, wie es um die im Stadtbild sichtbar werdende Stadtgeschichte bestellt ist; Denkmalschutz ist gewiß der wichtigste Aspekt solchen Bemühens, aber keineswegs der einzige.
Alststadtsituationen in Bochum?
Für den Wiederaufbau der kriegszerstörten Städte gab es quer durch Europa zwei einander entgegengesetzte Konzeptionen: Die eine knüpfte an die alte Stadtgestalt an, manchmal bis zur detailgenauen Rekonstruktion, häufig nur in Fortführung von Stadtgrundriß, Maßstäblichkeit und örtlichen Charakteristika, und die andere wollte auf einer grundlegenden Neuplanung eine “moderne Stadt” verwirklichen. “So kompromißlos etwa Rotterdam auf Neubeginn setzte, so energisch betrieb Polen die Rekonstruktion der verlorenen Warschauer Altstadt”. In der Bundesrepublik stehen Nürnberg für einen weitgehend exakten, Münster für einen annähernden Wiederaufbau der historischen Altstadt, München für die Wahrung der alten Strukturen in Stadtgrundriß, Maßstäblichkeit und Charakteristika, Frankfurt dagegen für die Errichtung einer amerikanisierten Hochhausstadt im Bruch mit aller Tradition.
Keine der Städte, die an ihre historische Stadtgestalt anknüpften, hat dies bereut. In München ist man heute geradezu froh darüber, daß eine in den Nachkriegsjahren diskutierte komplette “Neuordnung” des Innenstadtbereiches an der Finanzierbarkeit scheiterte und daher ein Wiederaufbau auf dem historischen Grundriß und in den überkommenen Größenordnungen erfolgen mußte; längst hat der Stadtrat für den alten Kern der Stadt ein Hochhausverbot beschlossen. In Frankfurt dagegen, wo man nach dem Krieg den entgegengesetzten Weg ging, wird heute versucht, wenigstens ein Stückchen der historischen Stadtgestalt durch aufwendige Rekonstruktionen zurückzugewinnen, wie wir einleitend bereits dargestellt haben.
Auch Bochum hat die weitgehende Zerstörung der Altstadt als Chance gesehen, sich ebenso gründlich wie endgültig von ihr zu trennen. Der Weilenbrink, ein romantisches Altstadtgäßchen, als “Malerwinkel” gerühmt, mit der kleinen, wegen ihrer Baugestalt im Volksmund “Pfefferdose” genannten Barockkirche wurde größtenteils von der Stadtkarte gestrichen. Dasselbe gilt für den “Alten Markt”, der zwar als Platz geblieben ist, bei dem jedoch nichts mehr an einen “alten Markt” erinnert und dessen Name gleichfalls aus der offiziellen Stadtkarte gelöscht wurde. An der Grabenstraße, einem im 18. Jahrhundert auf dem zugeschütteten mittelalterlichen Stadtgraben entstandenen altstädtischen Straßenzug, wuchsen moderne Geschäftsbauten, ebenso auf dem Gelände des historischen Freihofes nahe der “Drehscheibe”. Im Gerberviertel, dem ältesten Teil der Bochumer Altstadt, wurde das, was die Bomben stehen gelassen hatten, nachträglich abgeräumt; nur das Brauhaus Rietkötter trotzte auch allen späteren Abbruchbemühungen. Es ist neben der spätgotischen Propsteikirche und der im Renaissance-Stil errichteten Pauluskirche der Rest der Bochumer Altstadt.
Nach solch gründlicher Auslöschung der Altstadt durch Krieg und Nachkriegsplanung darf es für die letzten Altstadtfragmente nur eine kompromißlose Bestandssicherung geben. Darüber hinaus könnte es einer geschichtsbewußten Stadtgestaltungspolitik aber auch heute noch gelingen, manchen Bezug der neuen zur historischen Stadt im Stadtbild sichtbar zu machen. Natürlich kann es hier nicht um eine Rekonstruktion nach dem Beispiel des Frankfurter Römerbergs oder nach den beeindruckenden Altstadtrekonstruktionen in Polen gehen. Selbst wenn sie finanzierbar wäre – sie ist es nicht, sollte man sie nicht wünschen. Die “neue Altstadt”, das ist – von sehr begründeten, in Bochum aber nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen – ein Widerspruch in sich, wäre mangels konkreter Reproduzierbarkeit der untergegangenen Baugestalt historisches Disneyland und könnte höchstens vordergründige Nostalgie befriedigen, nicht aber historische Kontinuität belegen. Insoweit kann man der Vorgabe in der 1979 stattgefundenen Ausschreibung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs zum Aufbau des Gerberviertels nur zustimmen, es könne nicht Ziel einer Neugestaltung sein, “in diesem Viertel historisierend eine Altstadt durch Rekonstruktionen alter Gebäude entstehen zu lassen”, doch solle die Neubebauung “nach Dimensionierung, Nutzung, Geschossigkeit, Kleinteiligkeit und Vielfältigkeit in Funktion und Ausstrahlung der Atmosphäre eine alten Stadtkerns sinnfällig entsprechen”.
Diese Zielrichtung wäre automatisch erfüllt, zugleich aber auch die historische Altstadt in wenigstens einer Dimension erhalten, wenn man ihren Grundriß für eine Neugestaltung aufgenommen hätte. Eine kleinteilige, die alte Parzellenstruktur respektierende, den historischen Straßenverläufen von Große Beckstraße und Kleine Beckstraße, Gerberstraße und Spitzberg folgende, im verkitschende unechte Altstadtkopie vermeiden, einen wesentlichen Aspekt des historischen Gerberviertels jedoch erhalten: den Grundriß und seine Straßenzüge. Historische Stadtgestalt besteht ja nicht nur in der materiellen Substanz von Gebäuden. Stadtgrundriß und Stadtsilhouette gehören gleichfalls dazu und haben nicht minder stadtgeschichtliche Bedeutung. Ein Wiederaufbau des Gerberviertels, der den letzten, auch heute noch realisierbaren Altstadtelemente auf.
Ein städtebauliches Konzept für das Gerberviertel müßte auch den Raum südlich der Propsteikirche, den Rietkötter-Bereich und den “Alten Markt” mit einbeziehen, um die letzten Altstadtfragmente gestalterisch miteinander zu verbinden und aufeinander zu beziehen. Insbesondere der “Alte Markt”, in seiner gegenwärtigen Gestalt ohne historische Bezüge, aber auch ohne gestalterische Qualität, müßte wieder aufleben in einer Platzgestalt, die – allerdings nicht mit Rekonstruktionsversuchen oder den Effekten einer Disneyland-Historie – einen alten Markt erlebbar macht. Das Kuhhirtendenkmal am vorderen Platzrand und die gotische Stadtkirche im Hintergrund bieten interessante Rahmenbedingungen; durch eine gelungene Platzarchitektur könnte hier ein Stück Bochumer Originalität wieder erstehen. Vielleicht ließe sich jener Kandelaber, der den Platz vor dem Krieg schmückte und vor einigen Jahren in den Ruhrwiesen aufgefunden wurde, dabei als Versatzstück verwenden; vielleicht könnte auch die Plastik eines zeitgenössischen Künstlers historische Szenen diese dank Carl Arnold Kortum detailliert beschreibbaren Marktes zeigen, standen an oder auf ihm doch das mittelalterliche Rathaus, der Pranger, die Markthalle, die Stadt-Waage...
In dem für Bochum erstellten Stadtgestaltungsgutachten ist eine Platzfolge angeregt, die auf dieser Seite der Bongardstraße mit dem “Alten Markt” beginnt, sich über eine platzartige Ausdehnung zwischen Rietkötter-Haus und Kirchenhügel fortsetzt und mit einem weiteren Platzraum im Gerberviertel endet. Auf der anderen Seite der Bongardstraße soll dem Vorschlag zufolge der Turmbereich der Pauluskirche zu einem Platz ausgestaltet werden, der seinen bisherigen intimen Charakter nicht zerstört, aber eine Raumfolge eröffnet, die über den Dr.-Ruer-Platz zum Husemannplatz führt. Jeder dieser Plätze hätte seine individuellen stadtgeschichtlichen Bezüge; für die Platzräume im ehemaligen Altstadtbereich müßten sie sich aus dem vorindustriellen Bochum ergeben.
Wo keine andere Möglichkeit mehr besteht, bedeutende Zeugen der Ortsgeschichte im Stadtbild sichtbar zu machen, sollten Erinnerungstafeln auf sie hinweisen. In Anfängen ist dies bereits geschehen, doch zeigen Beispiele in Bochumer Nachbarstädten, daß es auch eindrucksvollere, über eine rein verbale Beschreibung hinausreichende Möglichkeiten gibt. Daß an historischen Bauten Erläuterungstafeln angebracht werden, müßte – wie dies vielerorts selbstverständlich und auch in Wattenscheid vorbildlich geregelt ist – in Bochum gleichfalls zunehmend möglich sein.
Die Wattenscheider Altstadt, der Bereich der vier Nachbarschaften der alten Freiheit, ging durch Bombenkrieg und Stadtsanierung verloren. Wo jetzt Karstadt ist, wurden Altstadt-Situationen, die den Krieg überdauert hatten, noch in den 60er Jahren dem Streben nach City-Geltung geopfert. Altstadtfragmente, die sich heute noch in Bauensembles von Old Wattsche und Rosenviertel finden und die letzte Zeugen der alten Stadt Wattenscheid sind, müßten auch hier konsequent erhalten werden. Es darf keine Frage sein, daß der reizvolle Platz am Rosenviertel restauriert und auf seine altstädtische Gestalt zurückgeführt werden muß. Auch eine weitgehende Substanzerneuerung die wohl unumgänglich ist, würde bei Wahrung der originalen Gestalt dank des kontinuierlichen Fortbestehens diese Teils der historischen Altstadt seinen Denkmalwert nicht in Frage stellen. Die in der politischen Diskussion gelegentlich lautgewordene Auffassung, im Rosenviertel sei das einzelne Fachwerkhaus unter Denkmalschutzgesichtspunkten ja gar nicht viel wert, sondern “lediglich” das Ensemble, ist zwar als Feststellung richtig, stellt aber die Wertigkeiten auf den Kopf. Da historische Gebäudegruppen geschichtliche Lebensformen weitaus besser verdeutlichen und städtebaulich weitaus prägendere Elemente des Stadtbilds sind als überkommene Einzelbauten, ist – auch nach politischer Bekundung aus der Bochumer Kommunalpolitik – “die Erhaltung einzelner, über das Stadtbild verstreuter Bauwerke”. Gerade weil die Bedeu-tung des Rosenviertels in seinem Ensemble-Charakter liegt, wäre aber der Kompromiß “teils abbrechen, teils erhalten” der Anfang vom endgültigen Ende, denn wenn der Ensemble-Charakter verlorengeht, ist auch der Rest nicht mehr erhaltenswert.
Die gleiche Bedeutung, die den Fragmenten der “Altstädte” von Bochum und Wattenscheid zukommt, wird man in den Stadtteilen, die früher selbständige Kirchdörfer und Bauernschaften waren, den Resten der ehemaligen Dorfkerne – wo es sie noch gibt – einräumen müssen.
Historische Aspekte der Stadtteil-Individualität
Das Landstädtchen Bochum wäre trotz des rasanten Bevölkerungszuzugs der Gründerzeit nie über die Größe einer Mittelstadt hinausgekommen, wenn nicht 1904 die Eingemeindung von Grumme, Hamme, Hofstede und Wiemelhausen, 1926 die von Hordel, Riemke, Bergen, Weitmar und Altenbochum, 1929 die von Laer, Querenburg, Gerthe, Werne, Langendreer, Linden-Dahlhausen und Stiepel und 1974 schließlich die Zusammenlegung mit Wattenscheid stattgefunden hätten. Nur zwei Prozent der heutigen Bochumer Bürger wohnen im ursprünglichen Bochumer Stadtgebiet, das auch nicht mehr als vier Prozent der heutigen Stadtfläche ausmacht. Bochum ist keine kontinuierlich aus einem Kern heraus gewachsene und damit durch eine einheitliche Entwicklungsgeschichte geprägte Stadt, sondern ein Konglomerat ursprünglich eigenständiger Ansiedlungen mit jeweils individueller Geschichte. Die heutigen Stadtteile waren vorher – ein Stück verkleinert – Kirchdörfer oder Bauernschaften. Nicht weniger als 14 heutige Stadtteile und Ortsbereiche von Bochum wurden um 880 n.Chr. im Werdener Urbar erwähnt und damit zwei Jahrhunderte früher, als Bochum selbst zum erstenmal in einer Urkunde auftaucht.
Ihre Geschichte ist reich facettiert. Die “Freiheit Wattenscheid” war Zentrum eines mittelalterlichen Dekanatsberzirks, zu dem auch Bochum gehörte. Harpen hatte sich schon im hohen Mittelalter zur “parochia”, also zur selbständigen Pfarrei entwickelt, Stiepel, Weitmar, Lingen, Ümmingen und Langendreer waren Kirchdörfer, also Mittelpunkte weiträumiger, aus mehreren Bauernschaften bestehender Kirchspielbezirke.
Die historische Bezeichnung “Herrlichkeit Stiepel” lebt auch heute noch im Volksmund als “Königreich Stiepel” fort, und das “Gericht Langendreer” hat gleichfalls eine besondere Territkorialgeschichte. Als Linden, Dahlhausen, Stiepel und Weitmar bereits aufblühende Bergbaugemeinden waren, galt Bochum noch als verschlafenes
Landstädtchen. Die ruhrtalnahen Siedlungen, die heute südliche und südöstliche Stadtteile Bochums sind, erlebten noch die Frühform des “Hohlengrabens” und die Bauerndörfer im nördlichen Amte ein Anwachsen um Zechenkolonien, die bald größer als sie selber waren. Die Probleme der Gründerzeit des Ruhrgebiets mußten sie alle selber meistern.
In einem ausgeprägten Stadtteilbewußtsein der Menschen des Ruhrgebiets lebt diese alte Eigenständigkeit fort. Durch die vielzitierte Beobachtung, daß man im Sprachgebrauch der Einwohner von Langendreer, Linden oder Gerthe “nach Bochum fährt – analoge Beispiele gibt es in den meisten Revierstädten -, wird dies ebenso belegt wie im Bemühen um den weiteren Gebrauch der alten Siedlungsnamen in der der Ortsbeschilderung. Es ist wohl auch kein Zufall, daß die ortsgeschichtliche Literatur des Reviers seit Jahren ständig neue Stadtteil-Monographien produziert.
Zu der häufig sicher unbewußten Eingebundenheit in die Geschichte eines Stadtteils kommt der Wunsch nach überschaubaren Lebensräumen. Der Stadtteil kann – wie die Kleinstadt – ein solcher überschaubarer Raum sein, die Gesamtstadt nicht mehr. Dieser Grundbefindlichkeit des Menschen muß die Kommunalpolitik Rechnung tragen, indem sie die Stadtteile als eigenständige Lebensräume respektiert, die ihre jeweils eigenen Spezifika haben und eine eigene Stadtteil-Identität entwickeln. Stadtteil-Individualität, das Bewußtsein, kein austauschbarer Allerweltsort zu sein, schafft Atmosphäre, schließlich heimatliche Bedingungen und damit Lebensqualität.
Da der Stadtteil unverwechselbare Besonderheit und örtliche Individualität vor allem aus seiner eigenen Geschichte gewinnt, muß diese seine Ortsgeschichte in seinem Stadtbild ablesbar bleiben. Jeder Bochumer Stadtteil ist folglich nach Zeugen eben dieser eigenen Geschichte zu befragen, und die steinernen Belege der Wattenscheider, Weitmarer, Lindener oder Gerher Geschichte sind ortshistorisch nicht minder bedeutsam als die der Stadtgeschichte Bochums.
Das war in der Vergangenheit nicht selbstverständlich. Als 1974 um Abbruch oder Erhalt der Silvester-Kapelle – Zentrum des spätmittelalterlichen Kirchspiels Weitmar – gerungen wurde, anerkannte der Kulturdezernent der Stadt zwar, daß die Kapelle “ein Beitrag zur Formulierung der Geschichte dieser Stadt” sei, meinte jedoch, ihr Stellenwert hänge “von dem Standort ab”. Der oberste Kulturbeamte konkret: “Wenn so ein Torbogen in der City, etwa auf dem Gelände neben dem Rathaus vor der Christuskirche stünde, würde ich unbedingt für seine Erhaltung stimmen. Aber in der Randzone, in Weitmar?” Als die nach dem Bochumer Stadtgestaltungsgutachten “einmalig schönen Fördertürme der ehemaligen Zeche Lothringen”, von der Bevölkerung “als Mittelpunkt und Wahrzeichen Gerthes und der damit verbundenen Geschichte angesehen” und nach Prof. Wienands “unbedingt” in die Ortsgestaltung zu integrieren, schließlich doch abgebrochen wurden, äußerte ein Sprecher der Stadt lapidar, man könne doch nicht jede Schachtanlage erhalten, und außerdem habe Bochum ja schließlich sein Bergbaumuseum und seinen Malakowturm in Hordel. Die Einsicht, daß weder das Deutsche Bergbaumuseum noch der Malakowturm eines anderen Stadtteils die Geschichte der Industriegemeinde Gerthe auszudrücken vermögen, fehlte bei der Stadt.
Eine geschichtsbewußte Stadtgestaltungspolitik muß erhalten, was die Bergbaugemeinden des 19. Jahrhunderts prägte, ebenso aber auch das, was aus der vorausgegangenen Ortsgeschichte an Objekten von stadtteilgeschichtlicher Bedeutung blieb.
Dorfkirchen
Für die alten Dorfkirchen der ehemaligen “Kirchdörfer” ist dies sicher unumstritten, mindestens insoweit, als sie noch in Funktion sind oder gar – wie die von Stiepel und Harpen – zu den Kleinodien der westfälischen Kunstgeschichte gehören, darüber hinaus aber wohl auch für die Kirchenfragmente von Weitmar und Ümmingen. Daß die seit dem 15. Jahrhundert erwähnte Lindener Antonius-Kapelle nach ihrem Abbruch im Jahre 1895 restlos aus dem örtlichen Stadtbild verschwunden ist, sollte wenigstens zu einer Erinnerungstafel am früheren Standort oder in dessen Nähe führen, ähnlich wie in Höntrop die Geschichte der 1862 abgebrochenen Kapelle des ehemaligen Leprosenhäuschens durch eine Relief-Plastik in der Tür der katholischen Kirche in Höntrop festgehalten wurde.
Friedhöfe
Zur historischen Kirche gehört immer auch der sie umgebende frühere Kirchhof; daher wurden die im Kirchenbereich aufgefundenen Grabsteine und Epitaphen regelmäßig auch im Umfeld der Kirche aufgestellt. Die Entstehungsperiode der dort erhaltenen Grabdenkmäler endet jedoch zumeist mit der Zeit, in der Napoleons Verfügung realisiert wurde, daß die Bestattung der Toten auf Grabfeldern vor den Städten und Dörfern zu erfolgen habe. In jenen Jahren entstand vor den Toren der Stadt Bochum der alte Friedhof und heutige Kortum-park, der zweifellos in seiner Gesamtheit ein Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes ist. Es entstanden aber auch vor den umliegenden Dörfern und heutigen Stadtteilen Friedhöfe, die inzwischen Grabdenkmäler von ortsgeschichtlicher Bedeutung enthalten: solche der alten, aus der Dorfgeschichte bekannten Bauerngeschlechter, von herausragenden Gestalten der lokalen Entwicklung, Gedenksteine der Grubenunglücke des 19./20. Jahrhunderts, aber auch bedeutende Zeugnisse der Sepulkralkultur. Sie alle sollten nicht spurlos verschwinden, wenn die entsprechenden Grabstätten eingeebnet oder neu vergeben werden. Es müßte auf allen Stadtteil-Friedhöfen einige Quadratmeter für den Bereich geben, in dem die orts- oder kulturhistorisch interessanten Grabdenkmäler in derselben Weise erhalten und aufgestellt werden, in der dies auf den historischen Kirchhöfen bereits geschieht.
Adelshäuser
Örtliche Geschichte präsentiert sich vor allem auch in den Rittersitzen des Landadels, die ja zumeist ihren Namen von der Ortschaft hatte, zu der sie gehörten: Haus Weitmar, Haus Langendreer, Haus Laer sind bis heute geläufige Beispiele dafür. Obwohl sie zumeist nicht in der Ortschaft selbst, sondern in räumlicher Distanz zu ihr errichtet waren, ist die Einbindung in die jeweilige Ortsgechichte doch intensiv und vielfältig.
Im heutigen Bochumer Raum gab es im späten Mittelalter fast drei Dutzend Rittersitze. Gewiß war nicht jeder von ihnen auch eine Burg. Manche unterschieden sich äußerlich kaum von einem großen Bauernhof (wie z.B. heute noch Haus Heven), andere waren im Gegensatz zur “Leichtbauweise” der bäuerlichen Fachwerkhäuser lediglich ein in Ruhrsandstein errichtetes “festes Haus”, woraus sich auch die häufige Bezeichnung Steinhaus, Steinhausen, Stenhus etc. ergibt und ganz allgemein die Vorbezeichnugen “Haus” für Landadelssitze. Nur bei einigen hat sich aus dem festen Haus auch ein mehr oder minder repräsentativer Herrensitz entwickelt und dann zu der umgangssprachlichen Bezeichnung “Schloß” geführt. Die Ruine Haus Weitmar liegt heute noch im “Schloßpark”, und von Steinen schreibt 1756 vom Haus Langendreer, es sei “ein schönes Schloß”. Schloßähnliches Gepräge hat sich bis in die Gegenwart Haus Kemnade bewahrt.
Von den fast drei Dutzend Rittersitzen des Bochumer Raums existieren noch fünf in geschlossener Baugestalt: Haus Kemnade (auf Hattinger Stadtgebiet, historisch jedoch als Teil von Stiepel), Haus Dahlhausen (als Reiterhof in Hordel), Haus Laer (als Wohnanlage) sowie Haus Heven und Haus Sevinghausen (als größere Bauernhöfe). Darüber hinaus gibt es von drei ehemaligen Rittersitzen noch Teile als Fragmente, Nebengebäude oder Ruinen: Haus Weitmar (als konservierte Ruine inzwischen dauerhaft gesichert), Haus Langendreer (in restaurierten Teilen, die in die Sonderschulanlage einbezogen sind) und Haus Lyren (von dem in Wattenscheid das 1798 errichtete Renteihaus steht).
Von den noch erhaltenen Bochumer Rittersitzen erweist sich Haus Dahlhausen als denkmalpflegerisches Sorgen-kind. Obwohl gegenwärtig noch als Reiterhof genutzt, ist das Herrenhaus doch deutlich sichtbarem Verfall preisgegeben. Mit den durch bergbaubedingstes Absinken des Grundwasserspiegels leergefallenen Gräften wurde der Baumrost aus 200 hochstämmigen Eichen, auf Erhaltung des Herrensitzes notfalls auch einiges an außergewöhnlichen Anstrengungen wert sein. Er ist einer der letzten im Bochumer Stadtgebiet noch geschlossen vorhandenen Rittersitze, historisch eines der bedeutendsten Adelshäuser des alten Amtes Bochum und auch von überregionaler Ausstrahlung. Daß das gegenwärtige Herrenhaus erst nach dem 1788 erfolgten Abbruch der Vorgängerburg im Jahre 1792 erneuert wurde, schmälert die historische Bedeutung der Anlage nicht, denn die Geschichte von Haus Dahlhausen reicht bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts zurück. Im 19. Jahrhundert verbindet sie sich zudem auch mit der hiesigen Bergbaugeschichte, denn die Bergarbeitersiedlung Dahlhauser Heide entstand auf dem Boden der ausgedehnten, bis nach Hamme hinüberreichenden Waldung des Rittersitzes, den Krupp im Jahre 1890 erwarb.
Die bergbauhistorischen Zusammenhänge zwischen dem Rittersitz Haus Dahlhausen, der denkmalpflegerisch sanierten “Kappeskolonie” und dem in das Westfälische Industriemuseum einbezogenen Malakowturm der Zeche Hannover sind so stark, daß der Rittersitz unbedingt erhalten bleiben muß, wenn Hordeler Berbau-geschichte einigermaßen geschlossen an noch vorhandenen Zeugen demonstriert werden soll.
Höfe und Kotten
Eine geschichtsbewußte, auf Stadtteilindividualität bedachte Stadtgestaltungspolitik darf in Bochum nicht über-sehen, daß die überschaubare Geschichte des Stadtgebietes gut ein Jahrhundert Bergbaugeschichte, zuvor aber ein Jahrtausend Agrargeschichte war. Dutzende der vor wenigen Jahrzehnten noch vorhandenen Höfe sind in ihrer Existenz über die Feuterstättenliste von 1664, die Türkensteuerregister des 16. Jahrhunderts und das 1486 angelegte “Schatboik in der Mark” ein halbes Jahrtausend, bei günstiger Quellenlage auch bis ins hohe Mittelalter zurückzuverfolgen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß solche bis heute erhaltene Höfe – auch ihre Reste oder Fragmente und auch in jüngerer Baugestalt – von “geschichtlicher Bedeutung” sind. Wo das Bauernhaus eines solchen Hofes bis heute erhalten blieb, stellt es ein Stück unverwechselbarer Ortsgeschichte dar. Das gilt insbesondere für die häufig recht attraktiven Höfe im Zentrumbereich der alten Bauernschaften, die geradezu repräsentativ für die Geschichte des jeweiligen Ortes sein können. Solche Hofgebäude gilt es unbedingt – auch bei veränderter Funktion – zu erhalten. Der Beckmann-Hof in Wattenscheid und die Fachwerkhäuser des Hofes Holhlleppel in Werne oder des Friemann-Hofes in Langendreer sind Beispiele für die Verkörperung örtlicher Agrargeschichte ihrer Bauernschaften, und in manchen weiteren Stadtteilen wurde es eben solche Zeugen der jeweiligen bäuerlichen Geschichte geben.
Die städtebauliche Einbindung des Bauernhauses Schulte Hiltrop im Zentrumsbereich diese (heutigen ) Stadtteils belegt auf eindrucksvoller Weise, wie ein solcher Repräsentant der Ortsgeschichte zum Mittelpunkt eines WohnQuartiers werden und durch eine auf ihn abgestimmte, qualitätvolle Neubauarchitektur kontrastieren zur Geltung gebracht werden kann. Die lokalhistorische Bedeutung eines solchen örtlichen Hofes ist weder durch ein zentrales Bauernmuseum noch durch Hofgebäude in anderen Stadtteilen aufzuwiegen. Das Bauernhausmuseum Kemnade und der Helfshof in Sevinghausen mögen attraktive Exponenten der Agrargeschichte der Hellwegzone sein, von ortsgeschichtlicher Bedeutung sind sie nur für ihre Stadtteile.
Was für den einzelnen Hof gilt, trifft erst recht auf das bäuerliche Ensemble zu. Das im Bochumer Raum bedeutendste ist wohl die Straßenbauernschaft Havkenscheid, mit der sich eine Frühform unserer Bauernschaftssiedlungen bis in die Gegenwart erhalten hat. Zwar ist nicht jeder der Höfe schon aufgrund seiner Architektur als Baudenkmal einzustufen, doch wird man die Gesamtheit der historischen Straßenbauernschaft als Denkmalbereich anzusehen haben. Aus diesem Grunde ist der Anfang 1982 vollzogene Abbruch des dazugehörigen Rittersitzes Haus Havkenscheid bedauerlich, auch wenn seine Baugestalt nicht mehr die eines typischen Rittersitzes war.
Ist in Havkenscheid die Siedlungsgestalt, einer historischen Straßenbauernschaft erhalten, so bewahrte sich Eppendorf in seinem Kern den Grundriß des alten Haufendorfes, bis heute mit verhältnismäßig umfangreicher und eindrucksvoller historischer Bausubstanz besetzt und durch Neubauten ergänzt, die sich in erfreulichem Maße an das alte Siedlungsbild angepaßt haben. Hier muß es über den konkreten Denkmalschutz für einzelne Objekte (z.B. für den seit 1486 nachweisbaren, seiner Bausubstanz nach aus dem Jahre 1672 stammenden Bodde-Kotten) hinaus Aufgabe einer die ortsgeschichtlichen Traditionen berücksichtigenden Stadtgestaltungspolitik sein, diese für Eppendorf typische Gestalt zu wahren und die malerischen Winkel zu erhalten.
Ähnliches gilt für Stiepel-Dorf im Kreuzungsbereich Kemnader Straße/Brockhauser Straße/Oveneystraße, wo die letzte größere Fachwerkhaus-Gruppe im Bochumer Stadtgebiet als Denkmalbereich geschützt und nach hoffentlich nicht sehr ferner Umleitung des jetzigen Durchgangsverkehrs über eine verlängerte Königsallee ein passendes Umfeld erhalten sollte.
Historisch interessante bäuerliche Ensembles sind auch einige teilweise erhaltene Kötterhaus-Gruppen, die in Beziehung zu nahen Rittersitzen standen, wie die einst von Haus Laer abhängigen “Gerger Höfe” an der nach ihnen benannten Höfestrape oder die Kotten der Klockerigge im Oberdorf von Langendreer, deren Kötter der Überlieferung nach beim Klang der “Glocke” vom Turm von Haus Langendreer zu Hand- und Spanndiensten erscheinen mußten.
Gründerzeithäuser
Die Entwicklung der alten Kirchdörfer und Bauernschaften zu großen Industriegemeinden spiegelt sich heute in den Resten der Schacht- und Werksanlagen, in den Arbeitersiedlungen, vor allem aber in der Gründerzeitarchitektur der Stadtteile. Als im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Arbeitskräfte zu Zehntausenden auch in den Bochumer Raum strömten und dadurch ein gewaltiger Wohnungsbedarf entstand, waren es außer den Arbeitersiedlungen und Menagen die Ergebnisse eines intensiven Geschoßwohnungsbaus, die ihn decken halfen. Er ersetzte die kleinen Höfe und Fachwerkkotten im Kern der alten Bauernschaften, weitete diese an ihren Randlagen aus und führte zu zusätzlichen Trabantensiedlungen; der Alter Bahnhof in Langendreer ist ein typisches Beispiel.
Architekturgeschichtlich fiel die Gründerzeit des Reviers in jene Periode, in der sich die Baukunst nach dem Auslaufen des Klassizismus den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stilrichtungen zuwandte, wobei sie den romanischen und den gotischen Stil für die Sakralbauten “reservierte” (Neoromanik, Neogotik), und für die Repräsentationsarchitektur der öffentlichen Gebäude sowie für repräsentative Wohnhäuser auf die italienische Renaissance (Neorenaissance), später auch auf Vorbilder des Barock und des Rokoko zurückgriff. Natürlich erreichten alle diese Vorbilder den Geschoßwohnungsbau der Industriegemeinden bestenfalls in schwachen Ansätzen. “Einfachere Gebäude erhielten in den 70er und 80er Jahren häufig nur einen glatten Putz, während die Fenster zurückhaltend mit Palmetten und kannelierten Pilastern geschmückt wurden. Einziges Ornament der sonst schmucklosen Seitenwände waren oft allegorische Darstellungen”. Dennoch entstanden hier auch Bauten, die durch reizvollen Stuck attraktiv gestaltete Schauseiten aufweisen, jene “Gründerzeitfassaden” in den verschiedenen Spielarten des Historismus, die seit Jahren durch zahlreiche gelungene (und einige weniger überzeugende) Fassadenrenovierungen farblich herausgeputzt werden.
Bis in die Nachkriegszeit galten diese Bauten als “pompöse”, “unehrliche”, “stillose” oder “kitschige” “Großväterarchitektur”, deren “billigen Stuck” man besser abschlug. Heute zeigen die Straßen des Ruhrgebiets, daß die Zeit, da der Historismus als minderwertig galt, vorbei ist, daß er seine eigenen Reize hat und sich deutlicher Wertschätzung erfreut. Die Stadt Bochum schließt sich dieser Bewertung ausdrücklich an. Sie richtet Fassadenwettbewerbe aus, und der Stadtbaurat bejaht “die stadtbildprägende Erscheinung der Häuser aus der Gründerzeit” und erkennt an, daß sie “in ihrer unmittelbaren Bildhaftigkeit speziell für unsere Ruhrgebiets-städte... ein willkommener Gegensatz zu vielen ästhetisch unbefriedigenden Bauten der Nachkriegszeit” sind.
Manche gelungene Reaktivierung einer alten Historismus- oder einer Jugenstil-Fassade in Bochum zeigt, daß hier trotz aller Zerstörungen des Krieges und einer verständnislosen Nachkriegszeit noch viel Kapital für eine Verbesserung von Stadtbild und Stadtgestalt brachliegt. In einer Straße, die einen Großteil ihrer ursprünglichen Bausubstanz im Bombenkrieg oder durch die “Modernisierung” zum Einheitsstil verloren hat, kann eine einzelne, farbig gestaltete Historismus-Fassade zum Blickfang werden und damit Wohnumfeldqualität bringen. Solche eingestreuten Gründerzeitfassaden sind vielleicht nicht einmal architekturgeschichtliche Sonderklasse, sind vielleicht – überregional gesehen – gründerzeitliche Dutzendware, aber in dieser Straße, die im übrigen nur stereotypen Rauhputz kennt, setzen sie Akzente, an dieser Stelle prägen sie das Stadtbild. Daher sind sie für diese Straße, obwohl andernorts vielleicht noch reichlich vorhanden und landesweit wenig originell – schützenswerte Bausubstanz. Dasselbe gilt analog für das Wohnquartier, den Ortsbereich, den ganzen Stadtteil, ja für die gesamte Stadt.
Die Gebäude im Stil des Historismus, “durch die besonders die Ruhrgebietsstädte entscheidend geprägt wurden”, müssen insbesondere dort erhalten bleiben, wo sie noch in größeren Komplexen existieren. Ganze Straßenzüge guter Jahrhundertwende-Architektur finden sich etwa in Wattenscheid, Langendreer und Linden. Reizvolle Ense-mbles des Historismus sind darüber hinaus in vielen Stadtteilen – nicht zuletzt an den großen Ausfallstraßen der Stadt – erhalten.
Das Stadtparkviertel, in dem sich ein ganzer Siedlungsbereich qualitätvoller Architektur der Jahrhundertwende in den unterschiedlichsten Ausprägungen des Historismus und des Jugendstils erhalten hat, sollte zusammen mit dem Stadtpark, dessen Denkmaleigenschaft zweifelsfrei ist, zu einem Denkmalbereich im Sinne des Denkmalschutzgesetzes zusammengefaßt werden. Zugleich müßte der alten Bausatzung wieder Geltung verschafft werden, die Bochums Stadtväter schon 1893 für das Stadtparkviertel erlassen haben; manche aus Kriegszerstörung und Abbruch resultierende Neubebauung hat sich bereits über sie hinweggesetzt. Aber die Stadt tat dies mit ihrem Museums(an)bau, dem auch einige Gründerzeithäuser geopfert wurden, selbst und war im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Hotelbau im Stadtpark erneut dazu bereit.
Bochum als “Stadt der Bergbaugeschichte”
Daß “die heutige sichtbare Stadtsubstanz Bochums erst in dem relativ ‚geschichtslosen‘ Zeitraum von rund 150 Jahren” entstand, ist nach dem für Bochum geschaffenen Stadtgestaltungsgutachten kein Grund, diesen “wenn auch noch so kurzen Werdegang” nicht als “Quelle für ihre eigene Identität zu nutzen ...”. Dieser Werdegang habe “ein solch reiches Erbe an gebauten Zeichen und Industrie-Denkmälern aller Art hinterlassen, daß Bochum mit all seinen Zechen-, Kühl- und Gastürmen ein ganz besonders einmaliges Stadtbild hatte ... – genau wie München und Nürnberg mit all seinen Kirchtürmen oder Nördlingen und Dinkelsbühl mit all seinen Wehrtürmen”. Wenn Bochum nicht in ein viel anonymeres Grau als das Grau der Zechen, nämlich in das des geschichtslosen internationalen Allerwelts-Einheits-Baustils unserer Zeit absinken wolle, müsse es alle verbliebenen gebauten Zeichen seiner ganz besonderen Entstehungsgeschichte genauso schützen, wie andernorts die Kirchtürme als Ursprünge der Besiedlung in Ehren gehalten würden.
Der Ursprung Bochums als Industriegroßstadt ist fraglos der Steinkohlenbergbau; er war die Ursache dafür, daß sich die kleinen Landstädtchen, die Kirchdörfer und Bauernschaften baulich ausdehnten und neue Ortsteile an ihren Rändern buchstäblich aus dem Boden gestampft wurden, daß sich zwischen ihnen im Umkreis der Schachtanlagen Trabantensiedlungen und Zechenkolonien bildeten, sich die baulichen Grenzen der Industriegemeinden bald so nahe kamen und sich das ganze Siedlungsgebiet so verdichtete, daß schließlich eine Großstadt aus dem Ganzen wurde.
Wie sich mittelalterliche Städte aus einer Burgmannensiedlung am Fuß einer Festungsanlage oder aus dem Marktflecken an einer zentralen Pfarrkirche entwickelten, die Stadt des Barocks als Herrschaftsmittelpunkt eines absolutistischen Fürsten entstand und diese Städte heute Burg, Kirche oder Residenz als ihren stadtgeschichtlichen Ausgangspunkt schätzen und darin das für ihre Stadt Besondere sehen, so wird eine Stadt, die den Schachtanlagen des Bergbaus ihre Großstadtwerdung verdankt, auch die für diesen typische Symbole zu bewahren haben. Diese Überlegung erschient auf den ersten Blick nur deshalb ungewöhnlich, weil die mittelalterliche Burg, die gotische Kirche oder das barocke Residenzschloß nur aus der zeitlichen Distanz bekannt sind, während die Attribute der Zechenlandschaft noch zu sehr gewohnte Alltagsumgebung und damit “nichts Besonderes” zu sein scheinen. Diese Perspektive wird jedoch schlagartig anders, wenn man sich gedanklich in eine Zukunft versetzt, aus der man auf Stahlfördergerüste mit der gleichen Mischung von Interesse und Amüsement zurücksehen wird, mit der wir uns heute die Haspel-Anlage und de Pferde-Göpel im Muttental anschauen.
Wenn Bochum seine historischen Identität aus der Bergbauzeit bezieht wie andere Städte die ihre aus anderen geschichtlichen Perioden, dann muß diese Stadt dem auch entsprechend sichtbaren Ausdruck verleihen, indem sie – wie mittelalterliche Städte Stadtmauern und Stadttore – ihrer Bergbauarchitektur stadtbildprägende Bedeutung einräumt und die Zeugen der Bochumer Bergbaugeschichte erhält.
Obwohl das Ende der bergbaulich-industriellen Phase gerade ein Vierteljahrhundert zurückliegt, ist von dem, was sie zu ihrer Zeit stadtbildprägend schuf, nur noch wenig zu sehen. In rasantem Tempo sind einst die Fördertürme, Schornsteine, Kühltürme und sonstigen Übertage-Anlagen des Bergbaus entstanden, nicht minder rasant vollzog sich ihre Austilgung. Um die Wende von den 40er zu den 50er Jahren unseres Jahrhunderts schrieb Emil Bardey in seinem Büchlein “Ein Bochumer über Bochum und die Bochumer”: “So weit das Auge reicht, nichts als Fördertürme, Schornsteine, Schutthalden, riesige Gasometer und nochmals Fördertürme, Schornsteine und Fördertürme. Das Panorama von Bochum.” Um die Wende von den 50er zu den 60er Jahren beginnt mit der Hohlenkrise das Zechensterben und damit der Abbau dieses Panoramas von Bochum. Die Fördertürme wurden demontiert, die Schornsteine gesprengt, die Schutthalden abgeräumt oder bepflanzt, die Gasometer abgebaut. Das “Panorama von Bochum” verwandelte sich in das einer Allerweltsstadt.
Die Gründlichkeit, mit der dies geschah, läßt eine Auswahl von zu Erhaltenem kaum noch zu. Von den sicher vier Dutzend Fördertürmen, die es damals im Gebiet der heutigen Stadt Bochum gab, existieren noch ganze drei: die Stahlfördergerüste von “Robert Müser” in Werne, von “Carolinenglück” in Hamme und von “Holland” in Wattenscheid. Auch sie blieben nur, weil sie noch Funktionen für die Wasserhaltung in nördlichen und nordwestlichen Bergrevieren hatten; für die 1973 stillgelegte Zeche Holland sind diese 1984 ausgelaufen, für die beiden anderen ist der Zeitpunkt, da sie ihre Funktion und damit ihre ökonomische Existenzberechtigung verlieren, absehbar.
Alle drei, die erfreulicherweise an sehr unterschiedlichen geographischen Punkten des Stadtgebietes stehen, sind von bergbaugeschichtlicher, aber auch von stadtbildprägender Bedeutung; so ist der Förderturm aus Werne als bergmännisches Symbol des Bochumer Nordostens von Gerthe bis Querenburg, von Laer bis an die Stadtgrenze von Witten zu sehen. Das Fördergerüst über dem Bergbaumuseum kann kein Ersatz für sie sein. Es hat seine Existensberechtigung als größtes Ausstellungsexponat des Museums, mag auch insoweit als Wahrzeichen für die Bochumer Stadtwerbung herangezogen werden, ist jedoch als ein von Dortmund transloziertes Ausstellungsstück kein Beleg der Bochumer Bergbaugeschichte.
Andere technische Übertage-Anlagen des Bergbaus sind außerordentlich rar oder kaum noch als solche erkennbar, wie der in seiner baulichen Substanz erhaltene Lüfterturm der Zeche Friedlicher Nachbar am Weitmarer Holz oder das zum Wohnhaus umgebaute Schachtgebäude der Zeche Hasenwinkel in Linden.
An Bergbauarchitektur ist die Stadt erfreulicherweise reicher, als sich auf den ersten Blick erkennen läßt. Zwar wurde die Zeche Friederika, die wohl die schönste Übertage-Architektur aller Bochumer Zechen hatte und vielleicht sogar ein wenig mit Zollern II in Bövinghausen konkurrieren konnte, längst abgebrochen, noch von manchen anderen Bergbauanlagen blieb das eine oder andere infolge neu gefundener Nutzungsmöglichkeiten erhalten. Das Fördermaschinenhaus der Zeche Lothringen (Gerthe) ist in seinen jugenstilartigen Formen sicher ein Kleinod hiesiger Bergbauarchitektur, aber auch das nahe der NS VII erhaltene Maschinenhaus der Zeche Dannenbaum und das der uralten Zeche Vollmond in Werne – wo Franz Dinnendahl die erste Dampfmaschine des westfälischen Reviers installierte – bieten qualitätvolle Industriearchitektur und sind historische Denkmäler der Bergbauzeit. Gebäude der ehemaligen Zeche Prinz Regent in Weitmar wurden unter weitgehender Erhaltung der zechentypischen Architektur auf geschickte Weise zu jener Kultureinrichtung umgebaut, die sich aus diesem Grunde “Die Zeche” nennt und das Bruchsteinmauerwerk, die Stahlträger und Laufkräne offen zeigt. Interessante Industriearchitektur findet sich darüber hinaus an zahlreichen ehemaligen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden des Bochumer Bergbaus. Es wäre eine wissenschaftliche Arbeit wert, den Bestand hiesiger Zechenarchitektur komplett zu ermitteln, architekturkritisch zu bewerten und in seinen bergbaugeschichtlichen Zusammenhängen darzustellen.
Geschehen ist dies bisher nur für die 33 vor 1914 entstandenen Arbeitersiedlungen des Bochumer Raums, von denen im Rahmen einer 1978 stattgefundenen Aufnahme und Bewertung 22 als erhaltenswert eingestuft wurden, davon die Dahlhauser Heide als besonders bedeutend. Deshalb wurde diese auch überregional herausragende, zwischen 1907 und 1915 im Zuge der Gartenstadt-Bewegung entstandene Bergarbeitersiedlung Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre im Rahmen eines aufwendigen Privatisierungs- und Erneuerungsprogramms nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert.
Ein solches Renommier-Objekt der Industriedenkmalpflege birgt allerdings auch seine politisch-psychologischen Gefahren. Leicht kann es zum Alibi gegenüber denkmalpflegerischen Anforderungen aus anderen, weniger hochrangig eingestuften, aber dennoch bedeutenden Bergarbeitersiedlungen werden. Da läßt sich unter Hinweis auf das Vorzeigeobjekt und die von ihm verschlungenen Millionen sehr schnell eine im übrigen restriktive Politik vertreten; so legte z.B. der Stadtenwicklungsausschuß des Rates am 12.6.1978 ausdrücklich fest, daß nur die Dahlhauser Heide als erhaltenswert auszuweisen und auf die Darstellung weiterer denkmalwerter Siedlungen zu verzichten sei. Und so geschah es. Ober besser: somit geschah weiter nichts, so daß – als im Juni 1980 bei der Borgholzwiese, einer gleichfalls im Zuge der Gartenstadt-Bewegung errichteten Zechensiedlung, die der Landeskonservator immerhin unter die zehn bedeutendsten Bergarbeitersiedlungen Westfalens eingestuft hatte, eine Modernisierungskampagne anlief, die “den Charakter der Siedlung im äußeren Erscheinungsbild unwiderruflich verändert” hätte, der Rat der Stadt Hals über Kopf eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung verabschiedete. Jetzt erst war eine Änderung der Bausubstanz genehmigungspflichtig und die Versagung der Genehmigung möglich, wenn diese Änderung nach Werkstoffwahl, Farbgebung, Konstruktion und Fassaden-gestaltung das Erscheinungsbild der Siedlung beeinträchtigte.
Eine weitere Gefahr ist ein aus dem Beispiel der Dahlhauser Heide erwachsender Erwartungshorizont, der leicht zu der Vorstellung führt, nur so sei Denkmalschutz bei Bergarbeitersiedlungen zu realisieren; da bekommen Kommunalpolitiker einer Stadt mit drei Dutzend Bergarbeitersiedlungen natürlich “kalte Füße”. Es geht deshalb nicht ohne die deutliche Klarstellung, das Denkmalpflege im Normalfall nicht Renovierung auf Kosten des Stadtsäckels bedeutet, sondern Erhaltung und Modernisierung in Gestaltformen, die den ursprünglichen Charakter des Ganzen nicht verfälschen.
Doch genau bei diesem Anspruch tritt ein weiteres Problem zutage: Während anmutige, mit Fachwerkschmuckgiebeln versehene, inmitten von Gärten freistehende Häuser vergleichsweise problemlos in ihren ursprünglichen Gestaltformen zu erhalten sind, ist dies bei den frühen, weitaus weniger attraktiven Ergebnissen des Bergarbeiterwohnungsbaus bedeutend schwieriger. Die ältesten, damit aber historisch besonders interessanten Zechenhäuser wurden im Volksmund “D-Zug” genannt, weil sie eine lange Kette aneinandergereihter, ebenso gleichförmiger wie schmuckloser Zweckbauten waren, ohne Vorgarten, mit Stall und “Plumpsklosett” hinter dem Haus. Der 1863 an der Heroldstraße in Werne errichtete “D-Zug” ist die älteste Bochumer Bergarbeitersiedlung und bildet zusammen mit der in den 70er Jahren desselben Jahrhunderts gebauten Kolonie “Deutsches Reich” ein “klassisches Beispiel für die Kolonien und Bergmannswohnungen der ersten Zeit”. In solchen Fällen zeitgemäßen Wohnkomfort nicht zu verweigern und den sozial- und siedlungs-geschichtlich bedeutsamen “ursprünglichen Zustand” dennoch nicht wegzumodernisieren, ist ein schwieriges, im Kompromiß jedoch lösungsfähiges Problem der Industriedenkmalpflege. Im übrigen bietet das Gros des Arbeiterwohnungsbaus erfreulicherweise Siedlungsformen, bei denen zeitgemäßes Wohnen und Erhaltung der alten Koloniegestalt einander nicht ausschließen.
Als schwieriger erweist sich die Erhaltung von Beispielen einer frühindustriellen Wohnform, die im 19. Jahrhundert für die noch unverheiratet oder zunächst ohne Familienanhang in Ruhrgebiet strömenden Arbeiter entstanden ist: die von Bergwerken und Industriebetrieben errichteten Logierhäuser oder Menagen. Das einzige in Bochum noch erhaltene ist die alte Menage der ehemaligen Zeche Friedlicher Nachbar in Linden nach Auf-fassung des Deutschen Bergbaumuseums “eines der interessantesten Zechengebäude im Bochumer Raum”, das nicht nur in architektonischer Hinsicht “als ein herausragendes Bauwerk anerkannt werden” müsse, sondern auch für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte von großen Interesse sei. Das Gebäude enthielt im Untergeschoß Ställe für die Grubengäule und in den anderen Stockwerken neben den Schlafräumen auch Beköstigungseinrichtungen sowie einen Laden, in dem die Bergleute einkaufen konnten. Angesichts der für ein solches Gebäude möglichen Nutzungen sollte seine dauerhafte Erhaltung nicht in Frage gestellt werden.
Die Frage der Nutzungsmöglichkeit wurde häufig zur Schicksalsfrage für ein Baudenkmal. Für Malakowtürme und Stahlfördergerüste gibt es sie zumeist nicht, was die Neigung, diese zu erhalten, gleich drastisch reduziert. Doch für mittelalterliche Stadtmauern, Stadttore und Burgruinen gibt es die in der Regel auch nicht, und man erhält und pflegt sie dennoch. Dies geschieht neben allen ideellen Motiven nicht zuletzt auch deshalb, weil sie schließlich doch noch einen (indirekten) Nutzen bringen: mehr Attraktivität für ihre Stadt. Leider sieht die Kommunalpolitik im Ruhrgebiet den Denkmalschutz noch vorwiegend als Last und begreift ihn nicht als Chance. Warum sollte eine Stadt, der es gelänge, die Geschichte des Bergbaus in Stadtbild und Stadtgestalt zu erhalten, weniger Anziehungskräfte entwickeln als eine Stadt der romanischen Kirchen, eine Stadt der mittelalterlichen Gassen oder eine barocke Residenzstadt?
Die Stadt Bochum, die sich schon früher selbstbewußt als “Schaufenster des Reviers” bezeichnete, wäre von allen Revierstädten am ehesten legitimiert, sich nun als “Stadt der Bergbaugeschichte” zu präsentieren. Albert Lassek, Bochumer Presseamtsleiter der ersten Nachkriegsjahre und passionierter Stadthistoriker, meinte in dem nach Kriegsende erschienenen Bändchen “Bochumer Skizzen” in einem Kapitel, das er “Bochums bergbauliche Sendung” überschrieb: “Viele Städte im Ruhrgebiet haben durch den Bergbau ihre wirtschaftliche Prägung erhalten. Es gibt unter ihnen aber keine Stadt, von der so viele Impulse zugunsten des Bergbaus ausgegangen sind ... wie von Bochum.” Tatsächlich ist die technik- und sozialgeschichtliche Bedeutung Bochums für den Ruhrbergbau unübertroffen.
Das Deutsche Bergbaumuseum, die Hordeler Anlagen des im Aufbau befindlichen Westfälischen Industriemuseums, der Geologische Garten mit seinen an die Erdoberfläche tretenden Flözen und seinen Karbonversteinerungen bilden einen musealen Grundstock. Bochums Mittellage zwischen den überregionalen bedeutenden Zentren der Bergbaugeschichte – von der Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen über die bergbauhistorischen Anlagen im Wittener Muttental bis zur Zeche Bonifatius in Essen-Kray – ist ein weiterer Vorteil. Vor allem aber vermöchte Bochum im eigenen Stadtbild ein so breites Spektrum der Bergbaugeschicht darzustellen, wie kaum eine zweite Ruhrgebietsstadt, reicht das Bochumer Stadtgebiet doch von der frühbergbaulichen Ruhr-Zone über die Hellweg-Zone bis an die Emscher-Zone heran und umfaßt damit die Abbaugebiete der wichtigsten Perioden der Bergbaugeschichte von den Anfängen bis zur Hochblüte des Steinkohlenbergbaus.
Auf der nördlichen, der Bochumer Seite des Ruhrtals finden sich zahlreiche Stollenmundlöcher der frühen Bergbauzeit, von denen drei inzwischen restauriert und zugänglich gemacht wurden: ein Stollen der Zeche Friedlicher Nachbar an der Lewackerstraße in Dahlhausen, der Gibraltar-Erbstollen am Kemnader Stausee und der St.-Mathias-Erbstollen an der Rauendahler Straße. Leinpfad und Ruhrschleuse aus der Zeit der Hohlen-Aaken auf der Ruhr und mancher alte Bergmannskotten aus der Zeit, da der Bergmann noch Landwirt und Kohlengräber zugleich war, belegen darüber hinaus die Anfangszeit des Ruhrbergbaus. Aus der Zeit der frühen Schachtanlagen existieren Fragmente des 1835 abgeteuften Eppendorfer Hector-Schachtes und das Schachthaus der Lindener Zeche Hasenwinkel. Von den in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts entstandenen Malakowtürmen finden sich im Bochumer Raum noch drei: der romantische Bruchsteinturm der Brockhauser Tiefbau im südlichen Weitmarer Holz, der Backsteinturm der Zeche Julius Philipp in Wiemelhausen und der inzwischen in das Westfälische Industriemuseum einbezogene wuchtige Malakowturm der Zeche Hannover in Hordel. Die aus der folgenden Generation der Förderanlagen gebliebenen Stahlfördergerüste wurden bereits dargestellt. Hinzu kommen drei Dutzend Bergarbeitersiedlungen – davon mehrere von herausragender architektonischer Bedeutung – und eine reichhaltige Zechenarchitektur. Bochum bietet, wie diese zusammenfassende Darstellung seiner bergbaulichen Industriedenkmäler zeigt, auch heute noch im Stadtbild einen Querschnitt durch die gesamte Bergbaugeschichte.
Hinzu kommt mancherlei kleine, aus privater Initiative stammende bergbauhistorische Reminiszenz: eine hier und dort in Erinnerung an die letzte verfahrene Schicht aufgestellt Hohlenlore, eine bergmännisch geprägte Schrebergarten-Atmosphäre, Bergbausymbole an mancher Hausfassade zum Beispiel. Elemente der Technik sollten nach den Vorstellungen des Bochumer Stadtgestaltungsgutachtens hinzukommen. Das Stadtbild sei, so heißt es dort, mit solchen “Versatzstücken als Träger von Bedeutungsinahlten” anzureichern, welche die Industriegeschichte dieser Stadt anbiete. Die in Gerthe aufgestellte Seilscheibe, die vom Bochumer Verein für die Pariser Weltausstellung gegossene Gußstahlglocke vor dem Rathaus sind inzwischen realisierte Beispiele, denen weitere folgen müßten. Wie reizvoll sich die unterschiedlichsten Industrie-Elemente gerade auch in ein Neubaugebiet einfügen lassen, ist im Bereich der Universität Dortmund überzeugend dargestellt. Ihr ästhetischer Reiz muß dem mancher modernen Metallplastik nicht nachstehen, ihr Identifikationswert wird den der letzteren bei der Mehrzahl der Bochumer Bürger weit übertreffen. Daß Stahlfördergerüste und Kühltürme “anonyme Skulpturen” einer beachtlichen Ingenieurkunst sein können, haben die großen, international anerkannten Fotodokumentationen von Hilla und Bernhard Becher längst nachgewiesen.
So könnte die Erhaltung und akzentuierende Herausstellung von Zeugen der Bochumer Bergbaugeschichte zweierlei bewirken:
- Im “Innenverhältnis” würden sie der Großstadt Bochum helfen, ihre historische Identität zu finden, ihren
Bürgern das Gefühl zu vermitteln, daß dies keine seelenlose Industriegroßstadt, sondern eine Stadt mit ganz
besonderen, sogar sehr eigenwilligen Geschichte ist;
- im “Außenverhältnis” könnten sie die Stadt auf eine außergewöhnliche und keineswegs alltägliche Weise
attraktiv machen, als eine historische Stadt besonderer Art: eine “Stadt der Bergbaugeschichte”.
Mit dem Letzteren verbindet sich als dritter Aspekt ihrer Bedeutung die städtebauliche Wirkung. Dies gilt jedoch nicht nur für die Industriedenkmäler der Bergbauzeit, sondern für alle Bauten von stadtgeschichtlicher Relevanz.
Das Ziel moderner Stadtgestaltungspolitik, eine abwechslungsreiche, architektonisch vielgestaltige und kontrastreiche Stadtgestalt zu verwirklichen, die ästhetische Reize in Architekturbildern und Raumfolgen bietet, läßt sich nicht zuletzt dadurch realisieren, daß die Architekturformen der verschiedenen Stilepochen im Stadtbild zur Wirkung gebracht werden. In dieser Zielsetzung verbünden sich Stadtgestaltungspolitik, Stadtbildpflege und Denkmalschutz. Sie können in einer Stadt wie Bochum, die nur relativ wenig Denkmalsubstanz von überregionale Bedeutung, aber ein beachtliches Bauvolumen von ortshistorischer Relevanz hat, nur gemeinsam ein Optimum ihrer Ziele – den Schutz historischer Bausubstanz einerseits und die Verwirklichung von Stadtgestaltqualität andererseits – erreichen; der Denkmalschutz, weil er nur so aus der Ecke eines kulturellen Sonderinteresses herauskommt, und die Stadtgestaltungspolitik, weil sie Stadtgestalt – jeden falls aufs Ganze gesehen – um so besser verwirklicht, je mehr es ihr gelingt, die verschiedenen Stilrichtungen der örtliche Architekturgeschichte im harmonischen Nebeneinander zu einem abwechslungsreichen und individuellen Ortsbild zu integrieren.
Die “generelle Verknüpfung von Denkmalschutz und Denkmalpflege mit der Stadtentwicklungspolitik, die sich um die verstärkte Integration von Städtebauförderung, Wohnungsbau und Denkmalschutz bemühen muß”, wie Städtebauminister Zöpel zu Recht betont, wird eine Politik zur Geschichte im Stadtbild auch davor bewahren, aus der Stadt ein großes Freilichtmuseum zu machen. Im übrigen sieht auch der Denkmalschutz sein Ziel nicht darin, “im museallehrhaften Sinne zu konservieren”, sondern will “im Rahmen der Stadtentwicklungspolitik den sinnvollen Einbezug des baulichen Erbes in das Leben von heute”.
Politik zur Geschichte im Stadtbild ist ja nicht modische Nostalgie, nicht Schwärmerei für Opas gute alte Zeit, nicht Konservierung der Stadt von gestern, sondern Gestaltung der heutigen Stadt in einer Form, die nicht ausläßt, daß sie auch gestern schon war und dies als ein eigenständiges, wertvolles Gestaltungselement ihres Heute schätzt und verwertet. Unter dieser Prämisse wird sie nicht um “eine Zukunft für unsere Vergangenheit” betteln, sondern selbstbewußt auf den Wert ihres Angebots für eine qualitätvolle Stadtgestalt von heute pochen. Auch in Bochum.
Christel Darmstadt
Das bißchen Farbe...
Gedanken zur Farbe im Bochumer Stadtbildeinst und heute.
Seit etwa 1_ Jahrzehnten darf wieder über ein Thema gesprochen werden, das seit Mitte der 1930er Jahre in Bochum, ja in ganz Deutschland tabu war: die Farbe im Stadtbild. Wenn ein Thema, das in der Vergangenheit schon verschiedentlich eine gewisse Bedeutung gehabt hat, wieder behandelt wird, kann ein Blick in die Geschichte sehr hilfreich sein.
Das Ackerbürgerstädtchen Bochum am Hellweg verfügte zwar seit Jahrhunderten über Stadtrechte, jedoch war seine überregionale Bedeutung eher gering. Dementsprechend ist in dieser Stadt – im Vergleich zu ähnlich alten Städten in Deutschland – nur eine bescheidene Bautradition zu finden. Kultbauten und alte Verwaltungsgebäude wurden zwar in Stein errichtet, Wohnbauten dagegen bis in das 18. Jahrhundert hinein vornehmlich in Fachwerk. Und diese Fachwerkbauten waren entsprechend der westfälisch-bergischen Tradition vorwiegend schwarz/weiß gestrichen. Insoweit dies eine freiwillig eingehaltene Farbsitte der hiesigen Region war, ist bislang unerforscht. Es wäre einmal interessant festzustellen, ob auch in der hiesigen Gegend der früheren Grafschaft Mark der Landesfürst die Farbgestaltung der Gebäude bestimmt hat. Denn dies kam zur Zeit des Absolutismus sehr häufig vor. Es gab Kleinstaaten, in denen alle Gebäude in einem einheitlichen Farbton gestrichen werden mußten. Lediglich das Schloß des Landesherren hob sich durch einen andersfarbigen Anstrich oder die Verwendung eines farbigen Steines von den Gebäuden der Untertanen ab.
In etlichen Bereichen hat der Preußische Staat die Traditionen der von ihm erworbenen Kleinstaaten übernommen. Das betraf auch die Farbgestaltung. Die preußischen Staatsfarben waren Schwarz und Weiß. Eine preußische Kabinettsorder von 1820-in Bochum erst am 4. Januar 1823 eingetroffen – bestimmte, das “öffentliche Gegenstände wie Geländer, Barrieren, Zugbrücken, Pfähle usw.” In dieser Farbkombination gehalten werden sollten. Vorher scheinen diese Farben nicht überall verwendet worden zu sein. Denn 1820 hatte König Friedrich Wilhelm III. Nach einer Bereisung des hiesigen Regierungssbezirks “mißfällig bemerkt”, da “die Nationalfarben ... nicht beibehalten worden sind”. Daß in diesem Zusammenhang die Hausanstriche nicht erwähnt wurden, lag wohl daran, daß die Fachwerkhäuser ohnehin schwarz/weiß waren.
In der Zeit der Romanik – um 1840 – erfolgte eine starke Hinwendung zur Natur. Das wirkte sich auch in der Baugestaltung aus. 1835 war erstmals ein Ziegelsteingebäude, die Bauakademie in Berlin, unverputzt gelassen worden. Dies war ein epochales Ereignis, das sehr bald Schule machte. Bochumer Neubauten wurden in der Folgezeit zunächst verschiefert oder in dem hier anstehenden Ruhrsandstein erbaut. Aber auch Ziegelbauten entstanden immer häufiger. Interessant ist, daß diese Fassadenmaterialien zwar in ihrer Naturfabigkeit wirken sollten, wegen ihrer gelegentlich farbigen Uneinheitlichkeit jedoch häufig mit einem farbigen, lasierenden Anstrich im Materialton überstrichen wurden.
Bedingt durch diese neue Bauauffassung galten nunmehr Fachwerkbauten in Deutschland als “Arme-Leute-Häuser”, ja als altmodisch. Stein- und Materialsichtigkeit waren modern. Folglich wurden viele Fachwerkhäuser entweder mit Putz versehen und in einem Steinfarbton gestrichen oder mit Holz verkleidet. Wegen der hohen Brandgefahr durften Holzverschalungen ab Mitte der 1880er Jahre nicht mehr verwendet werden. An ihre Stelle traten geprägte Blechverschalungen, von denen es auch heute noch etliche in unserem Stadtgebiet gibt.
Zu Beginn des Historismus – ab ca. 1860 – wurden fast nur noch Natursteinbauten oder verputzte und mit Stuck versehene Gebäude errichtet. Nun wird bis in die heutige Zeit behauptet, daß diese Gebäude entsprechend der klassizistischen Tradition nur weiß oder bestenfalls hellgrau gefaßt (gestrichen) waren. Nach neueren Forschungen trifft dies jedoch absolut nicht zu. Denn bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte man in bei archäologischen Untersuchungen in Griechenland und Italien festgestellt, daß die antiken Bauten zum Teil recht starkfarbig polychrom gestrichen waren. Entsprechend dieser vorgefundenen Polychromie wurden dann auch in den frühen 1860er Jahren Neubauten entsprechend gefaßt. Der Literatur zufolge haben diese Fassungen bei Laien und Fachleuten weitaus mehr Kritik ausgelöst als Zustimmung erfahren. Ob und inwieweit auch in Bochum Gebäude von dieser damals “modernen” Auffassung geprägt worden sind, ist unbekannt. Die Nachforschung in alten Akten war ergebnislos. Leider sind die Bauakten dieser Gebäude, die vielleicht noch Aufschluß darüber hätten geben können, im 2. Weltkrieg verbrannt. Vermutlich wird dieses Kapitel der Bochumer Baugeschichte weitgehend im Dunkeln bleiben.
Die Kritik an den starkfarbig gefaßten Gebäuden des frühen Historismus führte schließlich dazu, daß die Buntfarbigkeit im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr abnahm.
Es ist interessant, daß mit jedem Stilumbruch in der Architektur meist auch wieder eine stärkere Hinwendung zu farbig gefaßten Bauten verbunden ist. Dies geschah auch zur Zeit des Jugendstils. Schon Ende der 1890er Jahre war von den Avantgardisten in vielen Artikeln und auch Fachveranstaltungen beklagt worden, daß die Städte rau und trist seien. Mehr Farbe sollte diesem Mißstand abhelfen. Nach 1900 wurde in der Fachliteratur immer häufiger von starkfarbigen Gebäudeanstrichen berichtet, zunächst bewundernd, dann allerdings auch bald in recht kritischem Ton. Es ist anzunehmen, daß man sich auch in Bochum mit dieser neuen Welle schon früh befaßt hat. Denn 1904 wurde eine 1883 erlassene und erweiterte Baupolizei-Verordnung ausdrücklich bestätigt, in der es hieß, daß alle Gebäude “an der Straßenseite derartig hergestellt und unterhalten werden” müssen, “daß sie keinen schlechten Eindruck machen und kein öffentliches Ärgernis geben”. Man verpflichtete die Hausbesitzer sogar alle von der Straße aus sichtbaren Wand- und Dachflächen und sonstigen Bauteile in gutem Zustand zu erhalten, Verputz und Anstrich sooft als nötig zu erneuern”. Schließlich hieß es: “Für den Anstrich der Außenfronten dürfen keine stark blendenden, die Augen empfindlich belästigenden Farben verwendet werden.”
Regional unterschiedlich ging die Begeisterung für den farbigen Hausanstrich bereits um 1910 in Deutschland zurück. Interessanterweise wurde die Begrünung der Gebäude zu dieser Zeit stark propagiert. Besonders die Initiative der Stadt Nürnberg muß hierfür bahnbrechend gewesen sein. Der Bochumer Verkehrsverein setzte sich 1912 für die Verschönerung der Häuser durch Blumenschmuck an Balkonen, Fenstern und in den Gärten ein. Ein städtischer Gartenbauinspektor hielt Vorträge vor unterschiedlichen Gremien und Interessenvereinigungen, in denen insbesondere die verschiedenen Pflanz- und Pflegeanleitungen dargelegt wurden. 1913 gab es einen “Ausschuß für Stadtverschönerung”, der 1914 umbenannt wurde in “Bochum im Blumenschmuck”. 1913 wurde ein Blumenschmuck-Fassaden-Wettbewerb ausgeschrieben, an dem 63 Hauseigentümer mit ihren Objekten teilnahmen. 1914 folgte ein weiterer Wettbewerb.
Daß die Gebäude zwischen 1900 und dem Ausbruch des 1. Weltkrieges nur einfarbig waren, läßt sich aus den Schwarz-Weiß-Fotos der damaligen Zeit ableiten. Danach gab es sowohl insgesamt helle als auch insgesamt dunkle Gebäude. Weiterhin kamen Häuser mit dunklen Wandflächen und hellem Stuck und in umgekehrte Gestaltung vor. Die Gebäudefarbigkeiten auf zeitgenössischen Aquarellen und Ansichtskarten sind nur bedingt aussagefähig, da bei diesen Abbildungen die malerische Darstellung meist gegenüber der dokumentarischen dominierte.
Nach den Wirren der Kriegs- und der ersten Nachkriegsjahre setzte 1920 erneut eine Farbbewegung in der Architektur ein. Den zeitgenössischen Berichten und Abbildungen zufolge waren die frühen Gebäudefassungen sehr vielfarbig. In den Beschreibungen einiger Gebäude wurde besonders hervorgehoben, daß der Stuck durch einen malerischen, oft atektonischen Farbanstrich ersetzt worden ist.
Insgesamt müssen die Städte damals sehr trist ausgesehen haben, und die Armut war groß in Deutschland. So wurde Farbe als ein relativ preiswertes und dennoch wirkungsvolles Mittel zur optischen Stadtverbesserung angesehen. Die Begeisterung für diese Möglichkeit war so ausgeprägt, daß bereits 1926 in Hamburg der “Bund zur Förderung der Farbe im Stadtbild” gegründet wurde. Ihm gehörten viele engagierte Einzelpersonen, Vertreter Technischer Hochschulen, Angehörige von Ministerien bis hin zu kommunalen Baubehörden, Architekten, Maler, Denkmalpfleger und die Farbenindustrie an. Der Bund veranstaltete Fachtagungen, gab eine Zeitschrift heraus und beriet auf vielen Gebieten. Den Geschäftsberichten zufolge sind auch mehrere Informationsveranstaltungen in Bochum durchgeführt worden. Veranstaltungsorte und Zeitpunkte sind dabei leider nicht angegeben worden.
Insgesamt muß die Begeisterung für die Farbe im Stadtbild in den 1920er Jahren hier im Ruhrgebiet recht zurückhaltend gewesen sein. Während Ende der 20er Jahre aus fast allen Gebieten in Deutschland deutliche Fortschritte auf dem Gebiet der Farbe in der Architektur verzeichnet wurden, beklagten Vertreter des erwähnten Bundes, daß im westfälischen Industriegebiet eine ausgesprochene Zurückhaltung zu beobachten sei. Man führte dies auf die Schwerfälligkeit der Westfalen zurück. Wesentlich wahrscheinlicher ist allerdings, daß ob der starken Schmutzbelastung in den Innenstädten des Reviers ein farbiger Anstrich für sinnlos gehalten wurden. Denn Farbe und Gerüstaufbau kosteten auch schon damals ziemlich viel Geld.
Es ist daher zu vermuten, daß das Interesse an einer buntfarbigen Gebäudegestaltung aus den genannten Gründen auch in Bochum verhältnismäßig gering war.
Dennoch hielt man es seitens der Stadt wohl für erforderlich, insbesondere historische Gebäude unter Schutz zu stellen und auch Empfehlungen für deren Behandlungen auszusprechen. In einem 1925 erlassenen Ortsgesetz wurde aufgeführt, daß “die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten und baulichen Änderungen” an namentlich genannten “Straßen und Plätzen von geschichtlicher bzw. Künstlerischer Bedeutung zu versagen” ist, “wenn dadurch die Eigenart des Orts- oder Straßenbildes beeinträchtigt” wird. Für diese Bereiche der Stadt wurde in dem Ortsgesetz weiter gefordert, daß die Gebäude “in der Bauart... und der Farbe so hergestellt werden, daß sie in den architektonischen Merkmalen und der baulichen Eigenart der Straßen und Plätze und ihrer Bebauung einen diesen Merkmalen und der Eigenart entsprechenden Bestandteil bilden oder sich ihnen einfügen”. Und weiter hieß es:
“Wenn bei offener Bauweise mehrere Häuser zu einer Gruppe vereinigt werden, müssen die einzelnen Häuser in Form, Baustoffen und Farbe durchaus einheitlich ausgebildet und möglichst gleichzeitig ausgeführt und deren Ausführung in einer von Fall zu Fall festzusetzenden Frist gewährleistet werden.
Straßenseitige Einfriedigungen müssen in Form, Farbe und Baustoffen mit dem Gebäude des Grundstücks übereinstimmen und sich den Einfriedigungen der Nachbargrundstücke anpassen.” Es ist bislang unbekannt, inwieweit diese recht allgemein gehaltenen gesetzlichen Bestimmungen in die Praxis umgesetzt worden sind.
Überregional ging bereits Ende der 20er Jahre die polychrome Farbanwendung in der Architektur zurück. Für avantgardistische Architekten – und wer wollte damals wie heute nicht dazu gehören – war die einzig mögliche Baufarbe Weiß. Das 1919 gegründete Bauhaus hatte sich durchgesetzt. Weiß galt als die Farbenfülle an sich, Weiß war die Farbe der absolut funktionalen Architektur, bunte Farben wurden als ein Stück Romantik abgelehnt.
Ab den 30er Jahren setzte eine große Begeisterung für Grau ein. Grau galt als der Ausdruck der gemeinschaftsbildenden Kraft im Menschen, als die symbolische Farbe des Städters im Gegensatz zum Bauern, als die Farbe der großen Arbeit, als die Lieblingsfaben der Architektur. Auch Denkmalpfleger waren der Meinung, daß insbesondere für die älteren Gebäude ein lichte bis mittleres Grau die einzig richtige Farbe sei. Und sogar der “Bund zur Förderung der Farbe im Stadtbild” empfahl 1931 für die “sehr groben und unruhigen mißförmigen Fassaden (etwa im Barock der 80er Jahre) ... eine graue Tönung” zu wählen.
Sehr dunkelgraue bis schwarze Gebäudeanstriche insbesondere in den Industriegebieten gehen auf einen Erlaß der 1930er Jahre zurück. Danach sollten vor allem große Mietwohnhäuser sehr dunkel gestrichen werden, damit sie im Kriegsfalle nicht so schnell aus der Luft ausfindig gemacht werden könnten.
Auf diesem Hintergrund und natürlich auch bedingt durch den 2. Weltkrieg entfielen für 40 Jahre fast jegliche Farbanwendung und damit auch jegliche Auseinandersetzung über die Baufarbgestaltung. Bunte Farbtöne an Gebäuden wurden streng gemieden und verachtet. Sie waren einfach kein Thema. Weder an den Technischen Hochschulen und den Universitäten noch an den Malerfachschulen erfolgte ein Lehrangebot zu diesem Bereich. Lediglich unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten wurde dieses Thema manchmal behandelt. Verständlicherweise ging es dann aber nur um die historische Baufarbigkeit, die angesichts der dominierenden Weiß-Grau-Phase oft genug unbeobachtet blieb.
Ende der 1960er Jahre setzte eine neue Farbbewegung in der Architektur ein. Sie wurde stark durch die Pop-Welle aus Amerika beeinflußt.
Nach dem das Münchener Stadtbild zur Olympiade farbig aufpoliert war, wollten auch die übrigen Groß- und Mittelstädte in Deutschland nicht nachstehen. Nach 40 Jahren Farbastinen setzte eine regelrechte Farbeuphorie ein.
In Bochum erfolgte damals ein Künstlerwettbewerb zur farbigen Bunkerbemalung. Ziel war es, diesem großen und brutal wirkenden Baumassen – als Architektur kann man sie nicht bezeichnen – etwas von ihrer Härte und Tristesse zu nehmen. Dies ist zweifellos gelungen, und heute, nach vielen Jahren, wirken etliche dieser Objekte – trotz ihrer inzwischen erworbenen Patina – als belebende Elemente innerhalb der häufig noch immer grauen Stadtteile.
Bald wurden auch die Bochumer Wohnbauten von dieser neuen Farbwelle getroffen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (heute Kommunalverband Ruhr) in Essen hatte mit dem Slogan “Die Moderne ist trostlos und trist – Rettet den liebenswerten Kitsch” für 1974 zum ersten Fassadenwettbewerb im Ruhrgebiet aufgerufen. Viele Historismus- und Jugendstilgebäude wurden zum Freiwild für Popartisten. Bunt war einfach “in”. Und eine Bochumer Farbenherstellerfirma gab in dieser Zeit einen Werbeprospekt heraus mit dem Titel “Farbe wird durch Farbe schön”.
Bunt, ja sehr bunt wurde es im Ruhrgebiet – allerdings auch im übrigen Deutschland. So manche Farbpannen sind im Revier und auch in unserer Stadt zu beklagen. Dennoch soll hier weder Hauseigentümern noch Malermeistern ein Vorwurf gemacht werden. Denn es fehlte einfach an Gestaltungsgrundlagen und guten Farbbeispielen. Es gab ja – wie gesagt – in den letzten 40 Jahren kein Lehrangebot zum Thema Farbe in der Architektur.
Von der Stadt Bochum wurde bereits 1974 der erste Fassadenwettbewerb durchgeführt. 102 Hauseigentümer meldeten ihre Objekte an, 16 wurden prämiert. Doch auch den Jurymitgliedern müssen Kriterien für eine angenehm wirkende Fassadengestaltung gefehlt haben. Denn unter anderem wurde ein hell- und mittelblau schräg gesteiftes Haus mit gelben Fenstern ausgezeichnet. Angesichts der manchmal wenig gelungenen Beispiele in unserer Stadt erlahmte die Farbeneuphorie bald wieder. So meldeten sich zum Fassadenwettbewerb 1976/77 nur noch 50 Bewerber, 17 erhielten eine Prämie.
Zwischenzeitlich hatte überregional und auch in Bochum eine intensivere Auseinandersetzung zum Thema Farbe und Architektur begonnen. Erste Veröffentlichungen kamen auf den Markt. In der “dezenten” Farbigkeit wurde nun die Lösung gesehen. Der Mut zur farbigen Gestaltung nahm wieder etwas zu. So reichten denn im Fassadenwettbewerb 1978/79 immerhin 99 Bewerber ihre Objekte ein, 25 Preise wurden vergeben. Interessant war, daß beige/braune Gebäudefassungen dominierten. Beim Fassadenwettbewerb 1982/83 standen 78 Objekte zur Bewertung an. Es wurden schließlich 22 mit einem Preis bedacht.
Beim Vergleich der Objekte der vier Fassadenwettbewerbe innerhalb von 10 Jahren kann erfreulicherweise festgestellt werden, daß ein engagiertes Bemühen um angenehm wirkende Fassadengestaltungen zunimmt. Dennoch liegt noch vieles im Argen. Ziel von Fassadenwettbewerben ist es, besonders gute Objekte zu prämieren und sie damit gleichzeitig als positive Beispiele zur Einzel- und Stadtgestaltung herauszustellen. Problematisch werden solche Fassadenwettbewerbe und deren Bewertungen dann, wenn stadtpolitische Gesichtspunkte vorrangig werden. So gab es bereits ernsthafte Bestrebungen, Preise gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet zu verteilen, wobei die Qualität der Gebäudegestaltung zweitrangig werden sollte.
Heute – 1985 – setzt sich die herablassende Einstellung durch: “Das bißchen Farbe...” und gedanklich fügt jeder aus seiner Sicht hinzu “... das kann ich auch”. Angesichts der Farbpannen werden neue Gebäude wieder in klares Weiß, der angeblich “natürlichsten Farbe” für die Architektur, getaucht. Gelegentlich werden noch lila Akzente hinzugefügt, konsequent über viele Häuserblöcke. Schade, daß den Verantwortlichen nicht bekannt ist, daß Lila die unbeliebteste Farbe überhaupt ist.
Der Beton an den Gebäuden der Ruhr-Universität ist nach 20 Jahren schon so schadhaft, daß eine sehr gründliche Sanierung erfolgen muß. Und dabei geht es dann auch um Farbentscheidungen. Bei einem der Gebäude setzten sich wohl die Bauhausdogmatiker durch: Grau mußte es wieder werden, weil die Uni ja auch ursprünglich grau angelegt war. Doch ist es nicht Grau genug im Ruhrgebiet? Möglicherweise hat diese graue Gebäude Kritik erfahren. Denn nun erstrahlt ein weiteres Gebäude in einem brillanten Gelb über dem Ruhrtal. Es springt buchstäblich aus dem architektonisch sehr geschlossen und konsequent angelegten Gebäudeensemble heraus. Dessen nicht genug, wurden in einigen Etagen Teile der Brüstungen schwarz gestrichen, so daß optisch der Eindruck entsteht, die Brüstungen seien unterbrochen, ja sie existierten überhaupt nicht. Die klare architektonische Konzeption ist durch die farbige Gestaltung total zerstört worden. Wer mag hier für “das bißchen Farbe” zuständig gewesen sein?!
Seit der Energiekrise ist insbesondere in der Altbausanierung Wärmedämmung fast zum Thema Nummer 1 geworden. Dagegen ist nichts einzuwenden. Bedenklich wurde es allerdings, wenn der Farbenhersteller gleichzeitig – kostenlos – ein sogenanntes Farbkonzept mitliefert. Leider kann nicht immer davon ausgegangen werden, daß diejenigen, die mit Farben handeln, auch fundierte Kenntnisse in der Architekturfarbgestaltung besitzen. – Häufig wird die Farbgestaltung auch in eigener Regiegesellschaften und Behörden immer irgendeinen, der einen “guten Geschmack” hat und über “das bißchen Farbe” entscheiden kann.
Nachdem nun auch Nordrhein-Westfalen ein Denkmalschutzgesetz hat, wird wohl in einigen Monaten die Denkmalschutzliste für Bochum geschlossen werden. Viele Gebäude, die vor 10 Jahren noch dem Abbruchhammer preisgegeben worden wären, werden dann erfreulicherweise unter Schutz stehen. Erstaunlich ist nur, wie viele Vertreter aus den unterschiedlichen Fachbereichen sich nun in der fachgerechten Renovierung allgemein und bei der Farbgebung im besonderen selbstverständlich auskennen wollen. Dazu zählen auch die sogenannten Befund-Anhänger, die nur die vorgefundenen Farben an einem historischen Gebäude bei der Renovierung wieder aufzunehmen bereit sind. Die Befunderhebung ist sehr wichtig. Hier im Ruhrgebiet jedoch allein danach zu arbeiten, ist sehr bedenklich. Es ist nicht einzusehen, daß eine Region, die in früheren Zeiten wegen der hohen Schmutzbelastung weitgehend auf farbige Häuserfassaden verzichtet hat, auf alle Zeiten im Grau erstarren soll. Erfreulicherweise haben sich Denkmalschützer in der hiesigen Region von der dogmatischen Renovierung ausschließlich nach Befund weitgehend distanziert.
Andererseits werden gelegentlich lange Diskussionen darüber geführt, ob an einem unter Denkmalschutz stehendem Gebäude ein sechs Zentimeter dunkler Sockel als Schmutzkante aufgemalt werden darf oder nicht, während gleichzeitig (1985) nicht darüber nachgedacht wird, ob der einzige neogotische Zentralbau in Bochum eine atektonische Ausmalung erhalten darf.
Auch der neue Segen der Städtebauförderungsmittel gibt Anlaß zur Sorge, so erfreulich diese Finanzhilfen auch für die Städte sein mögen.
“Das bißchen Farbe” im Stadtbild entscheidet – wenn auch zusammen mit anderen Faktoren – maßgeblich über deren Charme oder Anmutungsarmut, um nicht zu sagen Langeweile. In wissenschaftlichen Untersuchungen ist inzwischen nach gewiesen worden, daß von der Farbe in der Architektur eine intensivere Reizwirkung auf die Menschen ausgeht als von der Bauform. Farben und Farbenkombinationen haben einen direkten Einfluß auf das emotionale Wohlbefinden, aber natürlich auch auf das Unbehagen der Menschen in der gebauten Umwelt.
Es gibt durchaus etliche sehr positive Beispiele für gute farbige Architektur in Bochum, die inzwischen auch überregional beachtet werden. Es ist zu hoffen, daß dem “bißchen Farbe” im Bochumer Stadtbild in Zukunft mindestens soviel Aufmerksamkeit geschenkt wird wie der sogenannten Verkehrsberuhigung oder anderen technischen Bereichen .
Martina Wittkopp, Jürgen Beine
Lebens- und Wohnqualität in Bochum.
Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt seit 1945.
In einem zu Beginn der 1980er Jahre von dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung der stadt Bochum herausgegebenen Bildband, der von A. Wolf in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur erstellt wurde und unter dem Titel “Bochum – Beiträge zur Zeitgeschichte” erschienen ist, wird im Vorwort von Oberbürgermeister Eikelbeck und Oberstadtdirektor Jahofer Bochum als eine “bedeutende Stadt” gewürdigt und insbesondere in diesem Zusammenhang auf die in der Stadt vorhandenen “Voraussetzungen für hohe Lebensqualität” hingewiesen. Demgegenüber betonen die Verfasser einer im Jahre 1984 publizierten Studie über die Folgen der tiefgreifenden ökonomischen Krise auf die soziale Lage breiter Bochumer Bevölkerungsschichten, daß “schwerwiegende Arbeitsplatzverluste, steigende Massenarbeitslosigkeit, zunehmende Verarmung breiterer Bevölkerungsschichten einerseits, erhöhte Belastung der Beschäftigten durch den Einsatz neuer Technologien, Arbeitsintensivierung und Angst um den Arbeitsplatz andererseits... die Wirklichkeit der Lebensverhältnisse in Bochum” prägen. Ist es nicht gerade zynisch, wenn angesichts der sich seit dem Ende der 1970er Jahre verschärfenden gesellschaftlichen Probleme in Bochum, die vor allem für breite Arbeitnehmerschichten mit starken Einbußen an Lebensqualität verbunden sind, behauptet wird, die Stadt biete “Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität”?
Die Ziele, die die Stadt Bochum mit der Darstellung ihrer Lebens- und Wohnqualität in den von ihr herausgegebenen Büchern und Broschüren verfolgt, sind abhängig von sozialökonomischen und politischen Entwicklungen, gleichzeitig aber auch ein struktureller Bestandteil der Bochumer Kommunalpolitik und somit selber ein Indikator für gesellschaftliche Veränderungen. Da wir die von der Stadt herausgegebenen Bücher und Broschüren als ein Element ihrer durch politische und ökonomische Motive gekennzeichneten Öffentlichkeitsarbeit verstehen, sollen zunächst strukturelle Gesichtspunkte der Entwicklung der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit analysiert werden. Dabei gehen wir von der Voraussetzung aus, daß Öffentlichkeitsarbeit unter bestimmten kommunikativen Bedingungen durchaus “einen produktiven Beitrag zum sozialen Wandel und zur Entwicklung der pluralistischen Demokratie leisten” kann und nicht in der Legitimation eigener Leistungen aufzugehen braucht. Unter Berücksichtigung von sozioökonomischen Veränderungen in der Bochumer Nachkriegszeit wird in einem zweiten Abschnitt anschließend die Lebens- und Wohnqualität unter drei Gesichtspunkten analysiert. Neben der Darstellung der Qualität der Bochumer Wirtschaft und der Wohn- und Freizeitqualität Bochums wird anhand der Bücher und Broschüren die Frage untersucht, wie in ihnen der Einfluß kommunalpolitischer Maßnahmen auf die Entwicklung der sozialökonomischen und kulturellen Verfassung der Stadt und damit auf die Lebensqualität dargestellt wird. In einem zusammenfassenden letzten Abschnitt soll die Frage untersucht werden, inwieweit die in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bochum vermittelten Identitätsmuster “glaubwürdig” sind. Dabei wurde insbesondere auch auf ideologiekritische Argumente, die im Rahmen der Soziologie vor allem von J. Habermans vorgebracht wurden, einzugehen sein.
Obgleich es nicht gerade an Versuchen mangelt, den Begriff “Öffentlichkeitsarbeit” in seinen vielfältigen Dimensionen zu beschreiben und inhaltlich zu präzisieren, so ist dennoch bislang keine historisch-soziologische Theorie der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt worden, auf die im Rahmen einer empirischen Analyse der Entwicklung der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit zurückgegriffen werden könnte. So wird z.B. “noch in einer neueren, interdisziplinär angelegten Studie betont, daß sich ihrer Identität befinde” und die “wissenschaftliche Erforschung der Öffentlichkeitsarbeit empirisch und theoretisch noch in den Anfängen stecke”.
Angesichts der Frage, welche Handlungszusammenhänge die Bochumer Öffentlichkeitsarbeit ausmachen und charakterisieren, wäre es zweifelsohne reizvoll gewesen, sich mit der frappierenden Mannigfaltigkeit an Definitionsversuchen auseinanderzusetzen. Obwohl diese Arbeit hier nicht geleistet werden kann, entbindet es uns nicht von der Notwendigkeit, strukturelle Bestandteile der Öffentlichkeitsarbeit einer Kommune zu benennen und für eine empirische Untersuchung zu präzisieren.
Unter kommunaler Öffentlichkeitsarbeit wird im folgenden das gezielte Bemühen einer Stadtverwaltung verstanden, Teilöffentlichkeiten der Gesellschaft durch den Einsatz bestimmter Techniken über Ausschnitte der städtischen Lebenswirklichkeit zu “unterrichten”. Dabei stehen die Ziele kommunaler Öffentlichkeitsarbeit in einem mehrdimensionalen Interessengeflecht. Die politisch motivierte Öffentlichkeitsarbeit beruht auf der Idee einer “bürgernahen Verwaltung”. Sie richtet sich deshalb vor allem an bestimmte Interessengruppen des Stadtbürgerpublikums. Demgegenüber begründet sich die ökonomisch motivierte Öffentlichkeitsarbeit vor allem auf der Vorstellung, die wirtschaftlichen Potentiale einer Stadt und damit indirekt auch die finanzielle Stiruation des städtischen Haushaltes zu verbessern. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit, die von Public-Relationsfach als Imagearbeit bezeichnet wird, richtet sich insbesondere an Wirtschaftsunternehmen, Zuzügler und an mögliche potenielle Besucher der Stadt. Die von ökonomischen Interessen geleitete Öffentlichkeitsarbeit ist so ein integraler Bestandteil der Andiedlungspolitik und der Fremdenverkehrsförderung der Kommunen.
Weil die Städte eine breite, schier ausufernde Oszillationsskala an technischen Möglichkeiten anwenden, um gesellschaftliche Teilöffentlichkeiten adäquat anzusprechen, ist es allein schon aus arbeitsökonomischen Gründen notwendig, sich auf eine in der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit praktizierte Technik zu beschränken: die Herstellung und Verbreitung von Büchern und Broschüren. Auf andere Techniken der Bochumer Öffetnlichkeitsarbeit wird nur dann rekurriert, wenn sie in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung und Verbreitung von Büchern und Broschüren stehen.
Obwohl es detaillierte Untersuchungen zu den gesellschaftspolitische Grundlagen und Funktionen von Öffentlichkeitsarbeit gibt, existieren bislang keine umfassenden historisch-empirischen Studien über die Entwicklungsstadien moderner kommunaler Öffentlichkeitsarbeit. Abgesehen von theoriegeleiteten Überlegungen zum Problem der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit, ist – soweit erkennbar – die Studie von F. Landwehrmann die einzige umfassende empirische Untersuchung über Grundprobleme der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit. Dieser vom Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk in Auftrag gegebenen Untersuchung liegen als Untersuchungsmaterial insbesondere die von den Ruhrgebietsstädten herausgegebenen Broschüren zugrunde. Dabei ist die vorwiegend quantifizierende Auswertung des Quellenmaterials von dem erkenntnisleitenden Interesse geprägt, die Struktur und Funktion kommunaler Öffentlichkeitsarbeit differenziert nach Zielgruppen zu analysieren und darzustellen. Da jedoch die Landwehrmann-Studie auf der Analyse der zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Broschüren basiert, werden historische Dimensionen der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit von Ruhrgebietsstädten kaum berücksichtigt, was abgesehen von der Materialfülle wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Interesse steht, Grundprobleme der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit von Ruhrgebietsstädten vergleichend darzustellen.
Die Aufgabe, gesellschaftliche Teilöffentlichkeiten über Ausschnitte der Bochumer Lebenswirklichkeit zu “unterrichten”, wird im Rahmen der Bochumer Stadtverwaltung vor allem von dem Presse- und Informationsamt und dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung wahrgenommen. Damit soll jedoch keineswegs verkannt werden, daß auch andere Ämter bzw. andere städtische Einrichtungen in das Geflecht der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit integriert sind.
In der Nachkriegszeit ist die Verwaltungsinterne Struktur der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit neu organisiert worden. So wurde die 1925 begründete, dem Hauptamt angegliederte “Verkehrs- und Nachrichtenstelle”, die insbesondere für die “zentrale Bearbeitung des gesamten Pressewesens” zuständig war und im Jahre 1938 in “Verkehrs- und Werbestelle” umbenannt werden mußte, im Jahre 1947 unter der Bezeichnung “Presseamt” eine selbständige Dienststelle. Diese wurde “dem Oberstadtdirektor... direkt unterstellt” und von dem Stadtinspektor A. Lassek geleitet. Zu den Dienstobliegenheiten des neubegründeten Amtes gehörte neben der “Nachrichtengebung” und dem “inneren Berichtdienst” die Übernahme von “Sonderaufgaben”, zu denen insbesondere der “literarische Dienst” und die “Stadtwerbung” zählten. Damit fiel nicht nur die “Bearbeitung der publizistischen Veröffentlichungen über Bochum und über städtischen Einrichtungen” in den Zuständigkeitsbereich des Presseamtes, sondern auch die für die Stadtwerbung relevante Gestaltung “stadteigener Drucksachen”. So wurde z.B. schon 1947 anläßlich der “Kunstausstellung ,Der Bergmann und sein Werk‘ ein bebildertes Erinnerungswerk herausgegeben”.
Neben der Neubegründung des Presseamtes 1947 wurde im selben Jahr eine dem Hauptamt angegliederte “Abteilung für Wirtschaftsförderung“ gebildet. Diese hatte ökonomische Interessen der Stadt Bochum zu verfolgen, war doch ihre Aufgabe, “für die Ansiedlung neuer Betriebe in den durch Kriegszerstörung und Demontagen leerstehenden Werkhallen der ehemaligen Bochumer Firmen zu sorgen”um somit das Ziel der “Förderung der Bochumer Wirtschaft auf allen Gebieten“ zu erreichen. Aus der Erkenntnis heraus, daß eine gezielte Wirtschaftsförderung nur im Zusammenhang mit einer stärkeren Verkehrsförderung möglich ist, wurde dann am 1. 7. 1950 das “Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung“ als selbständige Dienststelle geschaffen. Gemäß der Dienstanweisung vom 19. Juni 1950 hatte das Amt deshalb neben wirtschaftsfördernden Aufgaben vor allem auch die Verkehrsförderung zu übernehmen. Die Stadtwerbung, zu der z. B. die “Heranziehung, Durchführung und Unterstützung von Tagungen und Kongressen”gehörte, wurde damit als Teil der Verkehrsförderung diesem Amt übertragen, wobei die “eigentliche Stadtwerbung in Wort, Schrift und Bildjedoch weiterhin beim Presseamt verblieb. Im Jahre 1953 ist dann durch eine Verfügung des Oberstadtdirektors auch die “literarische Stadtwerbung“ dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung übertragen worden Obwohl die Aufgabe, die Bochumer Wirtschafts- und Finanzlage zu verbessern, primär von dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung seit Beginn der 1950er Jahre wahrgenommen wurde, versuchte jedoch auch das Presseamt in der Phase zu Ende der 1940er und zu Beginn der 1950er Jahre im Rahmen seines “Sonderaufgabengebietes“ der literarischen Stadtwerbung, z. B. durch einen bebilderten Sonderprospekt (Auflage 250 000 Exemplare), der 1949 in den Nachbarstädten verteilt wurdeoder durch “stadtwerbende Aufsätze und Bilder“ u. a. in Reisezeitschriften, potentielle Kunden zum Einkauf bzw. Auswärtige zu einem Besuch in Bochum zu bewegen. In diesem Zusammenhang ist auch die von A. Lassek mitgestaltete Monographie “Bochumer Skizzen“zu nennen, die im Jahre 1949 publiziert und vor allem auch als “besondere Geschenkgabe der Stadt“verteilt wurde. Daß die finanzielle Grundlage dieser Öffentlichkeitsarbeit äußerst dürftig war, ist schon allein daraus ersichtlich, daß im Haushalt der Stadt Bochum kein besonderer Posten für die “kommunalpolitische Publizistik“ vorhanden war.
Während mit der Neubegründung des Presseamtes im Jahre 1947 in neuer Form an eine Tradition aus den 1920er Jahren angeknüpft wird, zeigt sich in der Begründung des Amtes für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung eine neue Dimension Bochumer Kommunalpolitik. Auf dem Hintergrund der durch Kriegszerstörung und Demontage bedingten Zerrüttung der Bochumer Wirtschaft, der Abwanderung des Bergbaus nach Norden und der strukturellen Krisenanfälligkeit der Bochumer Wirtschaftverfolgte dieses Amt das ökonomische und finanzpolitische Interesse der Stadt, durch gezielte Maßnahmen die Wirtschaftsstruktur Bochums zu verbessern, um damit gleichzeitig “die Steuer- und Finanzkraft der Stadt“ ~‚ zu heben. Dennoch blieb in der Übergangsphase zwischen dem Kriegsende und dem verstärkt einsetzenden Wirtschaftswachstum in den 1950er Jahren die “literarische Stadtwerbung“ primär beim Presseamt, wobei jedoch dieser Aufgabenbereich, laut Verwaltungsbericht 1948—1952 und der Dienstanweisung von 1950, auch schon vom Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung in Angriff genommen worden war.
Zwischen 1953 und dem Ende der 1960er Jahre war die “Stadtwerbung“ und damit gleichzeitig auch die “literarische Stadtwerbung“ voll in dem Arbeitsbereich des Amtes für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung verankert. Nachdem somit die Aufgabe, für die Stadt zu werben, an dieses Amt übergegangen war, konzentrierte sich die Arbeit des Presseamtes bis zum Jahre 1969 auf die “Unterrichtung der Verwaltung und Öffentlichkeit”, die Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen, den Ausbau des “Bildarchives“ und die “kommunalpolitische Publizistik“.
Zum Zweck der “Aufklärung der Bürgerschaft”(!) produzierte das Presseamt erstmals im Jahre 1953 die “Bochumer Jahresschau“. Das Presseamt beschritt mit der Herstellung dieses Filmes, in dem die “Verwaltung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung und ... gegenüber der Bürgerschaft in Bild und Ton Rechenschaft über ihre Tätigkeit im abgelaufenen Kalenderjahr ablegte”, “neue Wege auf dem Gebiet der kommunalpolitischen Publizistik” Die “Bochumer Jahresschau”, die seit 1981 unter dem Titel “Bochumer Themen“ gezeigt wird, ist bis in die Gegenwart ein fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des Presseamtes geblieben.
Neben den obligatorischen Aufgaben des Presseamtes war zwischen 1953 und 1967 die Arbeit im Rahmen der kommunalpolitischen Publizistik” – Den Verwaltungsberichten dieser Zeit zufolge – zum einen durch die Herstellung weiterer Filme bzw. Farbdia-Serien gekennzeichnet und zum anderen durch die Herausgabe einer Stadtillustrierte (1956) mit dem Titel “Vier Jahre Bochumer Kommunalpolitik 1952/56” und durch die Her-ausgabe der Rechenschaftsberichte der Stadtverordnetenversammlung 1956 bis 1960 bzw. 1960 bis 1964.
Bis zum Jahre 1968 waren die in den Verwaltungshaushalten der Stadt Bochum ausgewiesenen Kosten für die “kommunalpolitische Publizistik” des Presseamtes — seit 1964 unter dem Begriff “Öffentlichkeitsarbeit” subsumiert –sehr gering. Lediglich in den Jahren, in denen das Presseamt einen Rechenschaftsbericht der Stadtverordnetenversammlung herausgegeben hatte, stiegen die Ausgaben deutlich an. Während so z. B. im Jahre 1963 die Aufwendungen für “kommunalpolitische Publizistik” 8000 DM betrugen, beliefen sich die dementsprechenden Kosten für “Öffentlichkeitsarbeit” im folgenden Jahr auf 83000 DM. Angesichts der Tatsache, daß im Jahre 1969 die Kosten für die “Öffentlichkeitsarbeit” des Presseamtes auf 130 000 DM anstiegen, sind jedoch die Ausgaben des Jahres 1964 noch vergleichsweise bescheiden.
Innerhalb des Amtes für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung ist zwischen 1953 und 1969 die “Stadtwerbung” und insbesondere die “literarische Stadtwerbung” u. a. ein Bestandteil der Verkehrsförderung. Da ein Haupttätigkeitsfeld der Verkehrsförderung die Organisation und Betreuung von örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen war, um vor allem auch auswärtige Besucher in die Stadt zu bringen, ist zu vermuten, daß die vom Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung hergestellten und herausgegebenen Bücher und Broschüren sich maßgeblich auch an die Veranstaltungsteilnehmer richteten. Darauf verweisen allein schon einige Titel der Broschüren, so z. B. der Prospekt “Nanu, Sie kennen Bochum nicht?” oder “Was erwartet uns in Bochum?”. In diesem Zusammenhang entfaltete das Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung eine verstärkte Aktivität bei der Erstellung und Herausgabe von Broschüren.
Zwischen dem Ende der 1950er Jahre und der Mitte der 1960er Jahre vollzog sich ein tiefgreifender Strukturwandel der Bochumer Wirtschaft. Auf dem Hintergrund der Bergbaukrise entfaltete dabei die Wirtschaftsförderung der Stadt Bochum ein verstärktes Bemühen, neue Betriebe in Bochum anzusiedeln. Stellvertretend für die vielfältigen, erfolgreichen Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderungspolitik sei hier nur auf die Ansiedlung der Adam Opel AG in Bochum-Laer und Bochum-Langendreer verwiesen.
Dieser Strukturwandel wurde begleitet von einer Neuakzentuierung der “Stadtwerbung“. War in dem Zeitraum von 1953 bis 1962 mit der “Stadtwerbung” insbesondere das Interesse verknüpft, das “Bochumer Wirtschaftsleben zu intensivieren” so stand ab Mitte der 1960er Jahre u. a. auch “die Sympathiewerbung im Vordergrund“~. Das Bestreben, durch “gezielte Informationen dasAnsehen der Stadt und des Ruhrgebietes.. . im In- und Ausland zu verbessern” ,zeigt sich z. B. darin, daß allein im Jahr 1967 “über 100 in- und ausländische Spitzenkräfte aus der Wirtschaft und aus großen Zeitungsverlagen im Rahmen von Stadtbesichtigungen mit den Problemen der Stadt Bochum vertraut gemacht”wurden. Es ist anzunehmen, daß diesen Besuchergruppen vom Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung spezielles Prospektmaterial über Bochum zur Verfügung gestellt worden ist, so z. B. die im Jahre 1968 von dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung herausgegebene und in Englisch, Französisch und Italienisch übersetzte Broschüre “Entscheidung für die Zukunft: Bochum”.
Während sich die Aktivitäten des Presseamtes im Bereich der “kommunalpolitischen Publizistik” bzw. der “Öffentlichkeitsarbeit” seit Mitte der 1950er Jahre nicht grundsätzlich veränderten, weiteten sich die Aufgaben des Amtes für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung im Rahmen der von ihm betriebenen “Stadtwerbung” aus. War die “literarische Stadtwerbung” bis zu Beginn der 1960er Jahre vor allem ein Bestandteil der Verkehrsförderung, so war sie danach auch in verstärktem Maße ein Element der Wirtschaftsförderung. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Ausgaben für die “literarische Stadtwerbung” zwischen 1956 und 1966 fast doppelt so hoch waren wie die Aufwendungen für die “kommunalpolitische Publizistik” bzw. für die “Öffentlichkeitsarbeit”wird deutlich, daß die Verwaltung der Stadt Bochum der “literarischen Stadtwerbung“ einen höheren Stellenwert beimaß als der “kommunalpolitischen Publizistik” bzw. “Öffentlichkeitsarbeit”. Insbesondere dokumentiert die “Sympathiewerbung” eine verstärkte Ökonomisierung des Bemühens der Bochumer Stadtverwaltung, gesellschaftliche Teilöffentlichkeiten über Ausschnitte der Bochumer Lebenswirklichkeit zu “unterrichten” Dieser Prozeß entspricht weitgehend der sich in dieser Zeit verbreiternden Vorstellung, daß der Ruf und das Ansehen der eigenen Stadt ein Kapital ist, mit dem man arbeiten sollte.
In der Zeit zwischen 1969 und 1976 war dann die “Stadtwerbung” ein Aufgabenbereich des Presseamtes. Neben den traditionellen Aufgabengebieten war das Presseamt, das 1971 aufgrund einer neuen Dienstanweisung in “Presse- und Informationsamt” umbenannt wurde, damit auch für die Erarbeitung von “Werbeschriften”und die “allgemeine Stadtwerbung” d. h. insbesondere auch für die Herausgabe von Prospekten und Bildbänden zum Zweck der Imageverbesserung der Stadt, zuständig. Trotzdem blieb laut den Verwaltungsberichten der Zeit die “literarische Stadtwerbung” zunächst noch ein Aufgabengebiet des Amtes für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung. Da seit dem Jahr 1973 jedoch in den Verwaltungsberichten beim Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung keine eigene Rubrik zur “literarischen Stadtwerbung” mehr enthalten ist, dürften sich die Aktivitäten des Amtes in diesem Bereich auf ein ganz und gar unbedeutendes Maß beschränkt haben.
Daß im Jahre 1969 die “allgemeine Stadtwerbung und die Koordination im Bereich der speziellen Stadtwerbung” dem Presseamt übertragen wurden, begründete sich vor allem aus dem Interesse, ein einheitliches “visuelles Erscheinungsbild” für die Stadt Bochum zu schaffen. Dabei war das Ziel, ein neues “Bochum-Layout” zu kreieren, an die Vorstellung geknüpft, den “Begriff ‚Bochum‘...wie ein Symbol, eine Gütemarke in das Bewußtsein des Betrachters” zu heben. Das “grafische Erscheinungsbild” der Stadt Bochum, das von einer Werbeagentur entworfen worden war, wurde seit dem Beginn der 1970er Jahre dann die Grundlage für die Gestaltung sämtlicher städtischer Druckereierzeugnisse.
Im Bereich der “Öffentlichkeitsarbeit” hat “das Jahr 1972 die Stadt Bochum einen wesentlichen Schritt nach vorn gebracht”. Durch die Begründung eines Informationszentrums wurde in besonderer Weise der Vorstellung einer “bürgernahen Verwaltung”Rechnung getragen. Daß dieser “vorbildliche Kommunikationsmittelpunkt”der erste seiner Art in der Bundesrepublik Deutschland –gewissermaßen eine “Marktlücke geschlossen” hat, wird insbesondere an den – wenn auch vielleicht etwas übertriebenen – Besucherzahlen deutlich.
Am 4. 3. 1971 ist für das Presseamt eine neue Dienstanweisung erlassen worden. Ein Vergleich mit der damit außer Kraft gesetzten Dienstanweisung von 1947 zeigt, daß in der neueren, bis heute gültigen Dienstanweisung die “Öffentlichkeitsarbeit und Informationstätigkeit” (§4) und die “Stadtwerbung” (§5) als gesonderte Aufgabenbereiche hervorgehoben werden.
Besonders bemerkenswert ist an der Dienstanweisung von 1971, daß die Erarbeitung von “Werbeschriften” ein Teilgebiet der “Öffentlichkeitsarbeit und Informationstätigkeit” des Presse- und Informationsamtes ist und nicht in den Aufgabenbereich der “Stadtwerbung” integriert ist. Dahinter verbirgt sich beispielsweise das Bemühen, durch eine “Vormietewerbung für das Schauspielhaus und die Bochumer Symphoniker” bestimmte gesellschaftliche Teilöffentlichkeiten zu einem Theater- bzw. Konzertbesuch zu motivieren.
Obwohl in den Verwaltungsberichten und den Haushaltsplänen der Stadt Bochum eine klare Trennung zwischen “Öffentlichkeitsarbeit” und “Stadtwerbung” enthalten ist, so dürften doch in der Praxis die mit diesen Aufgabengebieten verbundenen Aktivitäten ineinander übergreifen. So würden z. B. die anläßlich der 650-Jahr-Feier der Stadt Bochum durchgeführten “Werbeaktionen” immer auch als ein Element der “Öffentlichkeitsar-beit” zu verstehen sein, denn die Absicht der Initiatoren war u. a. auch von dem Interesse geleitet, “einen möglichst großen Kreis der Bürgerschaft und Vereine...zu aktiver Beteiligung an der Festwoche anzusprechen”.
Eine wichtige Technik ist in der Zeit zwischen 1969 und 1975 im Rahmen der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit entwickelt worden. Seit dem Jahr 1971 werden im verstärkten Maße “Bürgerversammlungen” organisiert, um die Bürger über spezielle Problemschwerpunkte (z. B. “Straßenbau Westtangente” und “Sanierung der Bergarbeitersiedlung Dahlhausener Heide”) zu informieren.
Neben einer verstärkten Bürgerinformation wird seit dem Beginn der 1970er Jahre die Herstellung und Verbreitung von Broschüren auch zu einem integralen Element der Stadtentwicklungsplanung. Dieses dokumentiert sich insbesondere in den Broschüren “Grünes Licht für den Stadtbahnbau” und “Stadtbahn Bochum – 1. Baustrecke”. Die finanziellen Mittel für die “Öffentlichkeitsarbeit” und die “Stadtwerbung” der Stadt Bochum stiegen in den Jahren zwischen 1969 und 1975 auf eine bis dahin nicht erreichte Höhe an. Diese Ausgabenintensivierung bei dem “Presse- und Informationsamt” ging bis 1972 mit einer verstärkten Wirtschaftsförderung einher.
Das Bemühen, die Attraktivität Bochums zu steigern, ist mit dem Interesse verbunden, die Bochumer Bürgerschaft stärker in stadtbezogene “Aktivitäten” der Verwaltung zu integrieren. Dadurch, daß die “Stadtwerbung” in der Zeit zwischen 1969 und 1976 ein Bestandteil der Arbeit des Presse- und Informationsamtes war, korrespondiert also das Bestreben, die Bochumer Bürgerschaft “aufklären” zu wollen, mit der Absicht, daß die Bürger ein positives Verhältnis zur eigenen Stadt entwickeln sollen, um sich gegebenenfalls damit auch zu identifizieren.
Nachdem im Jahre 1976 die “Stadtwerbung” von dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung übernommen worden war, entwickelte sich im Rahmen der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit eine klare Aufgabentrennung: Während die Arbeit des Presse- und Informationsamtes darin bestand, Gruppen der Bochumer Bürgerschaft über Ausschnitte der städtischen Lebenswirklichkeit zu informieren und zu “unterrichten”, versuchte das Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung, durch eine gezielte “Imagepolitik” Teilöffentlichkeiten außerhalb Bochums zu “unterrichten”
Im Bereich der “Allgemeinen Stadtwerbung“ war die Arbeit des Amtes für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung in den Jahren 1976/77 durch zwei Faktoren gekennzeichnet: Neben der Erstellung einer neuen Werbekonzeption galt es, “neue stadtwerbende Schriften und Werbeanzeigen zu erstellen”,was insbesondere auch aufgrund der kommunalen Neugliederung, d. h. der Eingemeindung Wattenscheids nach Bochum, notwendig wurde. So enthält z. B. schon der “Wirtschaftsreport” der Stadt Bochum detaillierte Angaben zu Wattenscheider Industrieunternehmen.
Neben der “konzeptionellen Planung stadtwerbender Maßnahmen” und der Weiterentwicklung des “werblichen Grundrasters”wurden seit 1978 in verstärktem Maße auch Public-Relations-Beiträge für überörtliche Publikationen verfaßt.
Da sich jedoch die städtische Finanzlage infolge der seit dem Ende der 1970er Jahre verschärft einsetzenden ökonomischen Krise rapide verschlechterte, konnten seit dem Beginn der 1980er Jahre “im Rahmen der allgemeinen Stadtwerbung neue Projekte nicht in Angriff genommen werden”. Dies bedeutete gleichzeitig, daß die Aktivitäten des Amtes für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung “auf das Vorhalten des z. Z. herausgegebenen Werbematerials beschränkt bleiben” mußten.
Auf dem Hintergrund der strukturell und konjunkturell bedingten Rezession der Bochumer Wirtschaft veränderten sich zu Beginn der 1980er Jahre auch die Ziele der Wirtschaftsförderungspolitik. Bis dahin galt es vor allem, die wirtschaftliche Struktur Bochums durch die Ansiedlung von neuen Betrieben in Wachstumsbranchen zu verbessern. Neben dieses Ziel tritt dann verstärkt das Bemühen, die in Bochum vorhandenen Arbeitsplätze, insbesondere durch die “Förderung neuer privatwirtschaftlicher Investitionen” und den “Abbau von Investitionshemmnissen”,zu sichern, eventuell auch neue Arbeitsplätze damit zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist auch eine vom Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung im Jahr 1985 herausgegebene Broschüre zu erwähnen, die vor allem als “Begleit- und Informationsmaterial” an Unternehmer ausgehändigt wird.
Mit seinen Aktivitäten im Bereich der “Öffentlichkeitsarbeit” knüpfte das Presse- und Informationsamt unmittelbar an die in der Phase zwischen 1969 und der Mitte der 1970er Jahre entwickelten Tätigkeitsfelder an. So ist insbesondere die Arbeit im Rahmen des Informationszentrums auch nach 1976 ein hervorstechendes Merkmal der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit.
Die vom Presse- und Informationsamt herausgegebenen Broschüren waren seit der Mitte der l97Oer Jahre als Reihe unter dem Titel “Informationsschriften des Presse- und Informationsamtes der Stadt Bochum”erschienen. Allerdings ist diese Serie seit dem Beginn der 1980er Jahre nicht konsequent weitergeführt worden, denn in einer neueren Broschüre über “Bochums Westtangente”findet eine Einordnung in die Reihe der vom Presse- und Informationsamt herausgegebenen Broschüren nicht mehr statt.
Der Erstellung der Broschüren liegen unterschiedliche Motive zugrunde. So wurde z. B. im Jahre 1977 anläßlich des l00jährigen Bestehens des Bochumer Schlacht- und Viehhofes in “Zusammenarbeit mit der Bochumer Fleischerinnung, den Großschlachtereien und den zuständigen Fachämtern”eine Festwocheveranstaltet, zu der auch eine Broschüreerschien. Neben das Motiv, aus Anlaß von “Städtischen Jubiläen” eine Broschüre zu gestalten, werden auch auf Anfragen von Bürgern in speziellen Angelegenheiten entsprechende Informationshefte hergestellt. So ist z. B.eine Broschüre über die Arbeit des Jugendamtes aus diesem Grund erarbeitet worden. Ein drittes Motiv, Broschüren an Teilöffentlichkeiten der Bochumer Bürgerschaft zu vertreiben, begründet sich aus dem Interesse, über politisch relevante Problembereiche der Stadt Bochum zu informieren. Diesem Komplex können neben den Broschüren, die sich mit umweltpolitischen Fragen ausein-andersetzen, insbesondere auch die Hefte über die “Westtangente” zugeordnet werden.
Als eine neue Technik im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des Presse- und Informationsamtes ist die 1981 im Informationszentrum eröffnete “Infothek”, die “Wissenswertes auf einen Blick”vermitteln will, zu nennen. In der “Infothek” werden “Faltblätter zum Mitnehmen”ausgelegt, die sich mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten beschäftigen.
Eine neue Qualität gewann die Öffentlichkeitsarbeit des Presse- und Informationsamtes im Rahmen der seit 1975 verstärkt durchgeführten Bürgerversammlungen.Zu diesen Bürgerversammlungen, bei denen vornehmlich Infrastrukturmaßnahmen der Stadt diskutiert wurden, erstellte das Presse- und Informationsamt besonderes Informationsmaterial”.
Bei der Entwicklung der Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Presse- und Informationsamtes zeigt sich, daß die Aufwendungen für dieses Arbeitsgebiet seit 1980 rückläufig sind. Oszillierten die Kosten für die “Öffentlichkeitsarbeit” zwischen 1976 und 1980 jährlich um etwa 250000 DM, so sanken diese danach kontinuierlich auf 115000 DM ab. Diese Entwicklung, die bei der von dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung betriebenen “Allgemeinen Stadtwerbung” ähnlich verlief, verweist in spezifischer Form auf die zunehmend angespannte Finanzlage der Stadt Bochum.
Formal zeichnet sich die Bochumer Öffentlichkeitsarbeit in der Phase nach 1976 durch eine klare Trennung zwischen der ökonomisch motivierten “Stadtwerbung” die vom Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung wahrgenommen wird, und der politisch motivierten, vom Presse- und Informationsamt durchgeführten “Öffentlichkeitsarbeit” aus. Mit dieser Aufgabenspaltung ging bis etwa 1980 eine Intensivierung der Informationspolitik des Presse- und Informationsamtes einher, ehe dann mit der zunehmend sich verschlechternden Haushaltslage eine Beschränkung der Aktivitäten eintritt. Die “Allgemeine Stadtwerbung”, die in der Phase bis 1976 ein integraler Bestandteil der Arbeit des Presse- und Informationsamtes war und insbe-sondere deshalb stärker in die “Öffentlichkeitsarbeit nach innen” eingebunden war, wird nach der Mitte der 1970er Jahre wieder stärker in ökonomische Interessen der Stadt Bochum eingeflochten. Auffällig ist in diesem Zusammenhang besonders, daß in den Jahren 1982/83 die Wirtschaftsförderungspolitik der Stadt Bochum verstärkt wurde, während die Ausgaben für die “Allgemeine Stadtwerbung” stark zurückgingen.
Eine grob vereinfachende Zusammenfassung der einzelnen Phasen der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit ergibt folgendes Gesamtbild. Eine “Aufbauphase” einer wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit, die in Bochum zwischen 1947 und 1953 verlief, endet mit der vollständigen Abspaltung der “Stadtwerbung” aus dem Aufgabenbereich des Presseamtes der Stadt. In einer “Konsolidierungsphase” zwischen 1953 und 1969 tritt die ökonomisch fun-dierte “Stadtwerbung” wesentlich stärker in den Vordergrund. Mit der Übernahme der “Stadtwerbung” in das Aufgabengebiet des Presse- und Informationsamtes geht dann in einer “Expansionsphase” der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit zwischen 1969 und 1975 eine werbepsychologisch fundierte “Politisierung” der “bürgernahen Verwaltung” einher. Durch die abermalige Abspaltung der “Allgemeinen Stadtwerbung” aus dem Arbeitsbereich des Presse- und Informationsamtes tritt die Bochumer Öffentlichkeitsarbeit in eine “Differen-zierungsphase” ein, d. h., die “Öffentlichkeitsarbeit” des Presse- und Informationsamtes versucht, durch eine gezielte Informationspolitik Bochumer Teilöffentlichkeiten im Sinne einer “bürgernahen Verwaltung” verstärkt zu integrieren, während das Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung bemüht ist, durch eine gezielte lnformationspolitik gesellschaftliche Teilöffentlichkeiten außerhalb Bochums in den schon seit 1950 verfolgten wirtschaftlichen Strukturwandel Bochums zu integrieren.
Die Herstellung und Verbreitung der Bücher und Broschüren, die von dem Presse- und Informationsamt und dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung herausgegeben wurden, erfolgte in den einzelnen Phasen der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit mit unterschiedlicher Intensität. Während z. B. in der Phase zwischen 1953 und 1969 von dem Presseamt insgesamt höchstens drei Broschüren herausgegeben wurden, so sind in der Zeit nach 1975 von demselben Amt weit über 15 Bücher und Broschüren bearbeitet worden. Allein schon deshalb ist es notwendig, sich bei der Analyse der Darstellung der Lebens- und Wohnqualität auf einige ausgewählte Bücher und Broschüren zu beschränken. Damit wird auch gleichzeitig auf eine Analyse der “Faltblätter” wie sie beispielsweise über die “Infothek” verbreitet werden, und der Zeitungen (Bochumer Bezirkszeitungen etc.) verzichtet. Auch wird bei der Analyse das jeweilige “Layout” der Broschüren außer Betracht gelassen.
Bei der Analyse werden stärker systematische als historische Gesichtspunkte berücksichtigt, denn es erscheint zweckmäßiger, die Broschüren und Bücher strukturell nach den für die Öffentlichkeitsarbeit primär verantwortlichen Ämtern zu ordnen. Bei der Untersuchung der Lebens- und Wohnqualität in den von dem Presse- und Informationsamt und dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung herausgegebenen Schriften ist versucht worden, die Broschüren möglichst repräsentativ entsprechend der jeweiligen Phasen der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit auszuwählen.
Eine Sonderform der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit dokumentiert sich in den Büchern zur Bochumer Stadt- geschichte und in den seit dem Beginn der 1980er Jahre von dem Presse- und Informationsamt verfaßten “Weg- weisern”.
In den historischen Sachbüchern zeigt sich vorrangig das Bemühen, die geschichtlichen Dimensionen der Individualität Bochums herauszuarbeiten. So wird beispielsweise immer auf die Erfindung des Stahlformgusses durch Jacob Mayerund die Entwicklung des Schauspielhauses “zu den führenden deutschen Bühnen”hingewiesen. Deshalb werden auch in diesen Büchern sozialgeschichtliche Aspekte (z. B. Fragen der Entwicklung der Familienstruktur etc.) weitgehend außer Betracht gelassen.
Bei den Bochumer “Wegweisern” handelt es sich um Broschüren, die sich an neu hinzugezogene Einwohner Bochums wenden und über das Einwohnermeldeamt auch direkt an diese Personengruppe kostenlos ausgegeben werden. Zweck dieser Broschüre ist es, diesen Einwohnern das “Einleben” in Bochum zu “erleichtern”. Deshalb enthalten die “Wegweiser” auch vor allem Hinweise zur Bochumer Infrastruktur.
Im Bereich der “kommunalpolitischen Publizistik” und der “Öffentlichkeitsarbeit” des Presse- und Informationsamtes sind in bezug auf die Herstellung und Herausgabe von Broschüren zusammenfassend drei thematische und damit in Zusammenhang stehende zeitliche Abschnitte zu unterscheiden: Zwischen dem Ende der 1940er Jahre und 1969 geht es in den Broschüren vornehmlich um die Darstellung der “Zusammensetzung und Arbeitsweise der Stadtverordnetenversammlung”, wobei jedoch auch schon städtische Entwicklungen in den Blick kommen. In der Zeit zwischen 1969 und 1976 verlagert sich der thematische Schwerpunkt der Broschüren dann verstärkt auf konkrete “Stadtentwicklungsprozesse”. In diesem Zusammenhang ist besonders die von dem Presseamt herausgegebene Broschüre “Grünes Licht für Stadtbahnbau” (1970) zu nennen. In der Phase nach 1976 findet dann im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Presse- und Informationsamtes eine starke Ausweitung der Themengebiete statt. Aus den vielfältigen Themengebieten, die in den Broschüren behandelt werden, werden hier lediglich die Hefte zu dem kommunalpolitisch virulenten Thema des Baues der “Westtangente” berücksichtigt.
Mit der “Stadtfibel” wurde in Bochum in der Nachkriegszeit ein “erster Schritt” auf dem Gebiet der “öffentlichen Meinungspflege”gemacht. Ziel dieser Broschüre war es, “um das Vertrauen der Gesamtbürgerschaft”zu werben. Diese Art der “Öffentlichkeitsarbeit” steht dabei mit dem Bemühen, so die “Fibel”, in Einklang, die “Bevölkerung über die kommunalen Lebensbereiche aufzuklären”.
Die Darstellung der Lebens- und Wohnqualität Bochums ist in dieser Broschüre von den Notständen der Nachkriegszeit geprägt. So werden im Rahmen einer zusammenfassenden Beschreibung der “kommunalen Aufbaujahre” insbesondere die “Wohnungsnot” und die “Schulraumnot”erwähnt. Wichtigster Punkt der Darstellung ist jedoch die Legitimation der Arbeit der Stadtvertretung: “Jeder objektive Betrachter muß anerken-nen, daß die jetzige Stadtvertretung in schwerster Zeit den ihr 1948 durch die Bürgerschaft gegebenen Auftrag zum Aufbau der Stadt in größter Aktivität, nach bestem Können und in demokratischer Selbstverwaltung zu ihrem Teil erfüllt hat”.
Mit der im Jahre 1970 herausgegebenen Broschüre “Grünes Licht für den Stadtbahnbau” verfolgte die Stadtverwaltung das Ziel, “die Bochumer Bürgerschaft über das Großprojekt Stadtbahn... zu informieren”. Dementsprechend werden in diesem Heft vor allem die geplanten Bau- und Streckenabschnitte in ihrer funktionalen Bedeutung für die Entwicklung des städtischen Verkehrsnetzes erläutert.
Der Bau der Stadtbahn wird als eine zwangsläufige Folge der Entwicklung der Verkehrssituation in Bochum verstandenund einleitend als drittes Bochumer Großprojekt der Nachkriegszeit – nach dem Wiederaufbau und der Bewältigung der Kohlenkrise – bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird auch die maßgeblich vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des “Entwicklungsprogramms Ruhr” (1968) mitgetragene Finanzierung erwähnt.
Durch den Bau der Stadtbahn werden, so die Broschüre, zweifellos große Belastungen (Baustellenlärm in der Innenstadt z.B.) auf die Bochumer Bürgerschaft zukommen. Diese Einschränkungen der Lebensqualität werden jedoch durch die “Zukunftsvisionen“ für die Innenstadt relativiert:
“Mit der Stadtbahn oder dem Auto unterirdisch direkt in das Ladenzentrum. Das jetzige Straßenniveau ist Fußgängerparadies”. Gezeigt werden soll damit letztendlich, daß durch die “Entscheidungen, die jetzt bei der Planung und beim Bau der Stadtbahn von Rat und Verwaltung getroffen wurden”, eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität bewirkt wird.
Mit den beiden Broschüren zur “Westtangente” versucht die Stadtverwaltung insbesondere, den geplanten und zum Teil auch schon fertiggestellten Bau eines Teilstückes des äußeren Stadtringes als eine “richtige Entscheidung” zu rechtfertigen. Zwar wird eingeräumt, daß der “umweltschonende Ausbau der Westtangente” sehr kostenaufwendig war – wie hoch die Kosten für den fertiggestellten Tunnel waren, wird allerdings nicht gesagt – jedoch angesichts der mit dieser Baumaßnahme verbundenen “Aufbesserung der Lebensqualität” zu vertreten ist.
Neben den technischen Problemen werden in den Broschüren zur Westtangente vor allem auch “ökologische” Argumente, die den Bau der Westtangente plausibel machen sollen, dargestellt. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, daß für den Bau der Westtangente erstmals ein “Grünordnungsplan”aufgestellt wurde.
Ein zweiter wichtiger Punkt in den Broschüren zur “Westtangente“ ist in dem abermaligen Hinweis zu sehen, daß der Bau der Westtangente eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Ziel der “Verkehrsberuhigung” darstellt und sich deshalb auch Kritiker zu der Auffassung durchringen werden, daß die öffentlichen Gelder in diesem Bauprojekt sinnvoll angelegt sind.
Ziel der Broschüren ist es demnach, den Bau der Westtangente als eine richtige politische Entscheidung zu legitimieren, um gleichzeitig dabei das Ziel, “die weitere Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt”voranzutreiben, zu betonen.
In den Broschüren, die zwischen dem Ende der 1940er Jahre und 1985 von dem Presse- und Informationsamt bearbeitet und herausgegeben worden sind, wird die Entwicklung der “Lebens- und Wohnqualität“ Bochums immer im Zusammenhang mit kommunalpolitischen Entscheidungen gedeutet. Dabei wird die Verbesserung der “Lebensqualität” immer als Resultat gezielter Politik von Rat und Verwaltung der Stadt Bochum gedeutet.
Bei der Analyse der von dem Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung herausgegebenen Broschüren ist eine funktionale Differenzierung nach den jeweiligen Verwendungszwecken notwendig. So sind die Broschüren, die im Rahmen der “Allgemeinen Stadtwerbung” erstellt werden und insbesondere damit für die “Verkehrs-förderung” konzipiert sind, von den Schriften zu unterscheiden, die für die “Wirtschaftsförderung” erarbeitet wurden.
Die im Rahmen der “Allgemeinen Stadtwerbung” für die “Verkehrsförderung” konzipierten und her-ausgegebenen Broschüren sind augenscheinlich durch zwei Vertriebstechniken gekennzeichnet:
Zum einen sind sie von den Besuchern und Gästen der Stadt als Einzelbroschüren zu erhalten, zum anderen werden die Broschüren mit anderen Prospekten zusammen in besonderen Prospektmappen ausgegeben. In der Zeit zwischen 1953 und 1969 sind, soweit erkennbar, zumindest drei unterschiedliche Mappen erstellt worden: Etwa 1957 eine Mappe mit der sogenannten “Trilogie”,zu Beginn der 1960er Jahre eine weitere mit dem Titel “Vieles spricht für Bochum”und zu Ende der 1960er Jahre eine dritte Mappe unter dem schlichten Titel “Bochum”. In der Zeit zwischen 1969 und 1976 ist dann eine neue Mappe, die wiederum die Bezeichnung “Bochum”trug, an auswärtige Gäste verteilt worden. In der Phase nach 1976 wurde schließlich die Mappe “Bochum – Stadt mit Pfiff” entworfen und an die Besucher ausgegeben. Im Jahre 1985 ist dann im Rahmen der “Verkehrsförderung” die Broschüre “Bochum – Stadt mit Pfiff”herausgegeben worden. Diese Broschüre ist jedoch bislang noch in keiner Mappe enthalten und in der Hinsicht auch die einzige der im folgenden erwähnten Broschüren.
Die für die “Allgemeine Stadtwerbung” vom Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung konzipierten und herausgegebenen Broschüren sind auf einen ersten Blick von ihrer inhaltlichen Struktur nur schwer zu vergleichen. Zum einen umgreifen die Broschüren einen Zeitraum von nahezu 3OJahren, eine Zeit, die in der Stadt Bochum durch tiefgreifende soziale und ökonomische Veränderungen gekennzeichnet ist. Zum anderen sind sie abhängig von der jeweiligen Sichtweise ihrer Verfasser, darüber hinaus vor allem aber auch, als struktureller Bestandteil der Bochumer Kommunalpolitik, von dem spezifischen Selbstverständnis der Stadtverwaltung, von deren Repräsentanten einer das Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung ist.
Dennoch finden sich übergreifend inhaltliche Schwerpunkte, die mehr oder minder in allen Broschüren aufgenommen worden sind. Folgende Schwerpunkte lassen sich grob verallgemeinernd nennen: Wirtschaft und Verkehr, Kultur, Bildung und Wissenschaft, Einkauf und Wohnen, Freizeit und Unterhaltung. Mit der Darstellung dieser Bereiche wurde zumindest explizit in den Broschüren seit den 1960er Jahren das Interesse verbunden, den Gästen und Besuchern Bochums die “Stadt nahebringen” zu wollen bzw. u. a. zu zeigen, “wo unsere Stadt am schönsten ist”, “welche Sehenswürdigkeiten sie zu bieten hat” und “was diese Stadt interessant und sehenswert macht”. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, daß fast jede Broschüre ein sehr spezifisches, aber plakatives Urteil über die Stadt Bochum formuliert: Aus der Stadt, “die, voller Dynamik...einen Strukturwandel erlebt, der in der Bundesrepublik ohne Beispiel ist”,wird Ende der 1960er Jahre “eine Großstadt voll Leben und Optimismus”, dann eine “City voller Fluidum und Flair”(1974), 1980 “eine moderne, lebendige Stadt, in der zu leben Spaß macht”,und schließlich 1985 “eine lebendige Großstadt”, “Mittelpunkt und Metropole einer Region”, “geistiges und kulturelles Zentrum”, “Erholungsziel mit viel Grün und beliebten Freizeiteinrichtungen”, “Stadt mit völkerverbindenden Ideen, weltoffen und europaweit”, kurzum “eine Stadt mit Pfiff”. Diese Klassifikationen der Stadt Bochum deuten schon daraufhin, daß die Broschüren von ihrer Grundstruktur her einen “stadtwerbenden Charakter” in dem Sinne haben, daß sie ein grundsätzlich mit positiven Merkmalen besetztes städtisches “Gesamterscheinungsbild” erzeugen und herstellen. Die Darstellungen dieses städtischen “Gesamterscheinungsbildes” sind einerseits zweifelsohne mit Sachinformationenund Fakten gefüllt, andererseits aber fast gar nicht in einer problemorientierten, kritischen Art und Weise aufgearbeitet. So wird z. B. das “Terminal” von Serra, dessen Ankauf durch die Stadtverwaltung innerhalb der Bochumer Bürgerschaft sehr heftig und kontrovers diskutiert wurde und als sehr umstritten galt, zwar mit dem Hinweis “das am heißesten umstrittene Stück” aufgeführt, gleichzeitig aber auch als “Jahrhundertwerk” apostrophiert und somit in seiner Umstrittenheit schon wieder relativiert.
Generell weisen alle Broschüren auf den besonderen Stellenwert Bochums hin. Dieses zeigt sich z. B. 1957 schon allein in der zentralen Verkehrslage “Treffpunkt und Kreuzung der großen Verkehrsadern durch das Ruhrgebiet: Bochum” und zeigt sich auch noch Ende der 1970er und der 1980er Jahre, denn “alle Wege kreuzen sich in der Mitte, in Bochum”. Abgesehen von der verkehrsgünstigen Lage der Stadt, dokumentiert sich der hohe Stellenwert der Stadt u. a. aber auch im Bereich der Bildung und Wissenschaft. Im Zusammenhang mit den Beschreibungen dieses Bereiches wird schon ein Unterschied in der Darstellungsweise in den Broschüren deutlich. So werden zwar schon in den 1950er und 1960er Jahren die Bildungsinstitutionen durchaus in einem positiven Selbstverständnis aufgeführt und als wichtiger Ausweis für ein gutes städtisches Bildungsangebot und -niveau gewertet, so “gesellen sich in Bochum den Geschenken der Natur in bunter Mannigfaltigkeit auch die des Geistes, von Wissen und Bildung”. Auch wird der Versuch unternommen, die eigenen Bildungsinstitutionen wie z. B. die Universität “als bedeutsamer Punkt... für die Geschichte der deutschen Wissenschaftspflege überhaupt” in umfassendere wichtige Zusammenhänge zu stellen. Gleichwohl wird aber erst nach Mitte der 1970er Jahre die Absicht deutlich, die eigenen Bildungsinstitutionen, die Bildungsbereiche in ihrer Besonderheit, wenn 7ücht sogar Einmaligkeit darzustellen. So gilt Bochum 1980 als “Stadt der Schulen” und bietet ‚ein Bildungsangebot, das den Bedarf zwischen Kindergarten und Universität deckt”, und “die größte Universität, die in der Nachkriegszeit gegründet wurde, steht in Bochum”. Der hier angedeutete Wandel von der “Imagepflege” zur ‚Imagebildung” läßt sich noch an anderen Beispielen aufzeigen. So wird in den 1950er und 1960er Jahren der Bereich der Einkaufsmöglichkeiten nur in der Hinsicht erwähnt, daß mit dem Ruhrpark ein neues Einkaufszentrum existiert, zu dem “von überall aus dem mittleren Ruhrgebiet ...die Käufer kommen”. Ende der 1970er Jahre ist Bochum “Modeboutique”, der Ruhrpark in Bochum gilt nach Umsatz als “die Nummer eins in Europa”, und “in Bochum zählt die wahrgenommene Chance nicht nur nach Heller und Pfennig, sondern nach Millionen”. Darüber hinaus ist es “das Flair der Großzügigkeit, das bummeln durch Bochum so beliebt macht”, wie auch die “individuellen Läden”, die “nirgendwo in der Region dominieren...so wie gerade hier in Bochum”. An diesem Beispiel zeigt sich deutlich, wie hier mittels spezifisch ausgewählten Substantiven und Adjektiven wie “Großzügigkeit”, “individuell” oder der eindeutigen Abgrenzung durch “nirgendwo” versucht wird, das “Gesamterscheinungsbild” der Stadt, das sich hier in einem Ausschnitt dokumentiert, auf eine Ebene zu stellen, die der Stadt in ihrer Erscheinungsform ein “einmaliges”, zumindest individuelles Gepräge gibt. Als letztes Beispiel soll noch der Bereich des Wohnens angeführt werden. Während ich in den 1950er und 1960er Jahren die Wohnqualität generell in “licht bebauten Stadtteilen” sowie in “schmucken Hochhäusern, licht gebauten Siedlungen und zahlreichen Wohnvierteln im grünen Vorland der Stadt”dokumentiert, wird die Wohnqualität Ende der 1970er und 1980er Jahre durch andere Merkmale gekennzeichnet. So gehört Wohnen mit Weitblick.... zu den Annehmlichkeiten”,wie auch das Wohnen neben Arbeit und Freizeit zum “Dreiklang der Lebens-qualität“gehört.
Mit den Broschüren, die im Rahmen der “Verkehrsförderung” von der Stadt Bochum herausgegeben wurden und werden, wird die Absicht verfolgt, ein spezifisches “Gesamterscheinungsbild” der Stadt zu erstellen. Dabei zeigt sich, daß die vielfältigsten Bereiche der städtischen “Lebenswirklichkeit” dargestellt werden. In diesem Zusammenhang wird allerdings deutlich, daß diese “Lebenswirklichkeiten” mit einseitig positiven Merkmalen belegt sind und jegliche problemorientierte Darstellung vermissen lassen. Dies begründet sich insbesondere aus dem Interesse, der Stadt nicht nur ein positives, sondern vor allem auch noch ein individuelles Gepräge zu geben. Dem liegt das Vorhaben zugrunde, der eigenen Stadt ein “Image” zu verleihen, das sie insbesondere auch von anderen Städten unterscheidet.
Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurde erstmals zu Ende der 1960er Jahre eine Broschüre herausgegeben. Dieser auf dem Hintergrund der damaligen Wirtschaftskrise erstellten Broschüre, die den Titel “Entscheidung für die Zukunft: Bochum”trägt, folgen dann der im Jahre 1976 herausgegebene “Wirtschaftsreport”und das im Jahre 1985 erschienene “Magazin für Wirtschaftsförderung”
Grundidee der Wirtschaftsförderungspolitik ist es, den Strukturwandel der äußerst krisenanfälligen Bochumer Wirtschaft durch eine Umverteilung der Arbeitsplätze in Wachstumsbranchen voranzutreiben. Deshalb richten sich die Broschüren vorrangig auch an Unternehmer und Manager aus diesen Branchen.
Die Darstellung der Lebens- und Wohnqualität Bochums in diesen drei Broschüren korrespondiert mit zwei Zielen: Zum einen geht es darum, Argumente zu liefern, warum “ein Unternehmer, der einen neuen Betrieb errichten will, hier im Zentrum des Ruhrgebietes günstige Voraussetzungen findet”,und zum anderen wird das damit in Zusammenhang stehende Ziel verfolgt, Bochum als hervorragenden Wohnort, der auch für kapital-kräftige Unternehmer reizvoll sein dürfte, zu “verkaufen”. Entsprechend dieser beiden Zwecksetzungen sind auch die Broschüren in einen Teil zur wirtschaftlichen Lage und einen Abschnitt zur infrastrukturellen Lage Bochums gegliedert.
Im Mittelpunkt der Darstellung der “Bochumer Wirtschaftskraft” stehen Aspekte des “Bochumer Arbeitsmarktes”, des “Absatzmarktes Bochum”, des “Bochumer Verkehrsnetzes”, der Innovations-möglichkeiten in Bochum, der Finanzierungsmöglichkeiten für “neue” Bochumer Betriebe und der in Bochum für Betriebsansiedlungen zur Verfügung stehenden “Gewerbe- und Industrieflächen”. Der “Bochumer Arbeitsmarkt” zeichne sich, so die Quintessenz der Broschüren, durch seine “qualifizierten Arbeitskräfte”aus, insbesondere, so das Magazin für Wirtschaftsförderung, bilden “auch Bochums Erwerbslose ein qualifiziertes Arbeitskräftepotential”. An der Bochumer Konsumstruktur wird vor allem hervorgehoben, daß “der Absatzmarkt Bochum eine Sog-Wirkung für vagabundierende Kaufkraft hat”.Daß Bochum ein “Verkehrsknotenpunkt” ist, braucht für diese moderne Großstadt eigentlich gar nicht besonders hervorgehoben zu werden, denn es führt halt “kein Weg an Bochum vorbei”.Auf die in Bochum vorhandenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Betrieben und der Ruhr-Universität und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (Technologieberatungsstelle Ruhr etc.) wird besonders im Magazin für Wirtschaftsförderung hingewiesen.Insbesondere soll damit ein effizienter “Technologietransfer”sichergestellt sein. Auf die Finanzierungsmöglichkeiten für Betriebe, die sich in Bochum ansiedeln wollen, wird vor allem im Wirtschaftsreport eingegangen. Dabei wird insbesondere auf die “regionale Wirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen“ und andere Programme (“Mittelstands-kreditprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen” und “ERP-Programm” ) hingewiesen. Nicht zuletzt wird im Rahmen der Darstellung der Bochumer Wirtschaftskraft auf die für Betriebsansiedlungen zur Verfügung stehenden “Gewerbe- und Industrieflächen” hingewiesen. Dabei wird insbesondere auf die “Möglichkeit der Grundstücknutzung im Wege des Kauf- und Erbbaurechtsvertrages”verwiesen.
Die Quintessenz der Darstellung der Bochumer Wirtschaftskraft in den Broschüren ist also, daß Bochum geradezu “einmalige” Voraussetzungen für Betriebsansiedlungen bietet und daß insbesondere das Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung “bei einer für die Stadt entsprechenden Bedeutung im Fall ihrer Betriebsansiedlung fast noch Wunder vollbringen”wird.
Im Rahmen der Darstellung des Bochumer Infrastrukturwertes wird neben den Bereichen der “Bildung”, der “Gesundheit”, des “Sozialwesens” und des .Sportes”besonders auch auf die Wohnkultur Bochums und die Erholungsmöglichkeiten in Bochum hingewiesen. Dabei wird vor allem auf die in Bochum vorhandenen Möglichkeiten “der Ruhe und Erholung”eingegangen. So wird z. B. hervorgehoben, daß für die “Erholung im Grünen von der Stadt Bochum allein 1.300 ha Grünflächen gepflegt werden”,daß das “Freizeitzentrum Kemnader Stausee ein Dorado für Wassersportler ist”und der “Volkspark in Hiltrop ein richtiges Kleinod”darstellt.
Mit den im Bereich der Wirtschaftsförderungspolitik hergestellten Broschüren, die vor allem auch an Unternehmer und Manager von Wachstumsbranchen gewissermaßen als “Gedächtnisstützen” ausgegeben werden, verfolgt das Amt für Verkehrs- und Wirtschaftsförderung das Ziel, für Bochum als “einmaligem” Standort für die Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben zu werben. Ökonomischer Hintergrund dieser Form der Imagepolitik ist dabei der verschärfte interregionale Konkurrenzkampf um Betriebe und Unternehmen.
Dementsprechend werden bei der Darstellung der Bochumer “Lebenswirklichkeiten” vor allem die für Betriebsansiedlungen “positiven” Merkmale des Bochumer “Wirtschaftslebens” hervorgehoben, insbesondere geht es dabei natürlich um den Nachweis der “Einzigartigkeit” der Standortvoraussetzungen Bochums.
Die inhaltlichen Darstellungsprinzipien, nach denen die im Bereich der Bochumer Öffentlichkeitsarbeit erstellten Broschüren aufgebaut sind, können grob zusammenfassend als ein Versuch gewertet werden, ein möglichst wenig problemorientiertes Bild der städtischen Lebenswirklichkeit und Individualität zu entwerfen. Deshalb werden die realen Lebens- und Wohnverhältnisse der in Bochum lebenden Menschen auch in keiner Broschüre thematisiert, und dies, obwohl doch gerade eine Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität dieser Menschen Hauptgesichtspunkt aller stadtbezogener Prozesse sein sollte. Woran liegt diese in den Broschüren deutlich erkennbare antiaufklärerische Tendenz?
Die Substanz und damit auch die Glaubwürdigkeit kommunaler Öffentlichkeitsarbeit tritt vor dem Hintergrund der soziologischen Diskussion über den “Strukturwandel der Öffentlichkeit”in den “Scheinkegel der Ideologie-Kritik”.
Die bürgerliche Öffentlichkeit, so die Quintessenz der von J. Habermas an dialektischen Denkmodellen entwickelten universalhistorischen Deutung von gesellschaftlichen Systemen, beruht ihrer Idee nach auf der “kühnen Fiktion einer Bindung aller politisch folgenreichen Entscheidungsprozesse an die rechtlich verbürgerte diskursive Willensbildung des Staatsbürgerpublikums”. In einer modernen, von Sozialtechniken beherrschten Gesellschaft zeigt sich nun in der von Institutionen, insbesondere also auch von Städten, betriebenen Öffentlichkeitsarbeit ein Verfallsprozeß der bürgerlichen Öffentlichkeit, denn das Bemühen um die Herstellung von Öffentlichkeit – der “Akt der Kommunifikation” – korrespondiert mit einem in spätkapitalistischen Gesellschaften vorhandenen “Legitimationsprozeß, der Massenloyalität verschafft, aber Partizipation vermeidet”. In bezug auf die kommunale Öffentlichkeitsarbeit bedeutet dies, daß Öffentlichkeit durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit “nur dann hergestellt wird, wenn Publizität zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele dienlich ist, um ihr Handeln akklamationsfähig zu machen”.
Damit entsteht die Frage, unter welchen Bedingungen die kommunale Öffentlichkeitsarbeit überhaupt einen produktiven Beitrag zur Stadtentwicklung leisten kann. Soweit erkennbar, wird es zunächst notwendig sein, den Bereich der “systematisch verzerrten Kommunikation”, der vor allem auch mittels Öffentlichkeitsarbeit verstärkt produziert wird, durch die Entwicklung einer wirksamen “Gegenöffentlichkeit”seiner inneren Unwahrhaftigkeit zu entkleiden.
1985 Bochumer Heimatbuch
Band 8
Herausgegeben von der Vereinigung für Heimatkunde Bochum e.V.
Verlag:
Schürmann & Klagges
Titelbildgestaltung:
„Schorsch-Design®" Georg Wohlrab, Heusnerstraße 17, Bochum
Gesamtherstellung:
Druckhaus Schürmann & Klagges,
Bochum ISBN-Nr. 3-920612-06-X