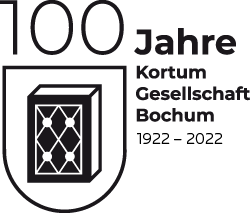Die Ausgrabungen in Bochum-Hiltrop
Karl Brandt
Wer über die flachwelligen Höhen im Norden der Stadt Bochum wandert, ahnt nicht, daß es sich hier um ältestes Siedlungsgelände handelt. Das Hochplateau, das unvermittelt am Südrande des Emschertales emporsteigt, erreicht hier die Maximalhöhe von 135 m, während die tiefsten Geländestellen des Emschertales bei 45 bis 50 m über dem Meeresspiegel liegen. Von Castrop-Rauxel über Herne-Süd, Bochum-Bergen und Bochum-Riemke kommend, geht dieses Hochplateau unmittelbar am Nordrand des Bochumer Stadtgebietes in das hochgelegene Gelände über. Seine Höhenlage verdankt dieses Gelände dem festen Untergrund, der aus dem Steinkohlengebirge besteht. Im Voreiszeitalter ist über dieses Hochplateau, wie die entsprechenden Schotterstreuungen bezeugen, die Ur-Ruhr geflossen. Wir dürfen hier von der Hauptterrasse der Ruhr sprechen, die bestand, als das Emschertal längst noch nicht vorhanden war, und die Hauptterrasse noch mit den gleichhohen Höhen von Recklinghausen zusammenhing. Zu einer Zeit, als sich die Ruhr längst ein anderes, von dem alten sehr abweichendes Bett gegraben hatte, erodierte ein anderer Fluß, vielleicht die Ur-Emscher, das breite Emschertal, über das wir schauen, wenn wir etwa auf den Höhen von Hiltrop, Bergen oder Riemke stehen.
Im Verlaufe vieler Jahrzehntausende wurde die in Urzeiten fast ebene Ruhrhauptterrasse, das jetzige Hochplateau, stark zergliedert. Durch Erosionsvorgänge entstanden Täler und Höhen, an deren Herausarbeitung auch das vordringende Inlandeis der nordischen Hauptvereisung hervorragenden Anteil gehabt haben muß. Dieses Inlandeis zerstreute die abgelagerten Ruhrschotter über weite Gebiete und vermengte sie mit ihrem Schutt (Geschiebe). Das läßt sich noch heute überall, wo wir Ruhrschotter auf und an der Hauptterrasse antreffen, nachweisen. Zu Beginn der letzten nordischen Eiszeit, vor vielleicht 100 000 Jahren, war die Zergliederung der Hauptterrasse schon sehr weit vorgeschritten. Während dieser Eiszeit wehten gewaltige Staubstürme auf die Höhen und ihre Hänge einen feinen, gelblichbraunen Gesteinstaub an, den Löß, den wir im Bochumer Gebiet bis zu 6 m Mächtigkeit nachweisen können. Wir können hier zwei Lößhorizonte ( 1 und 2) der letzten Eiszeit feststellen. Der obere ist rund 3 m mächtig und entkalkt. Wie mit einem dicken Mantel verhüllte er die spuren des Inlandeises, die wir als einzelne große Findlingsblöcke, sowie zusammenhängende Grundmoränen, die meist jedoch nur noch als Steinsohlen erkenntlich sind, unter dem Löß vorfinden. Diese Steinsohlen, zum größten Teil aus verlagerten Ruhrschottern mit geringen Beimischungen von nordischem Geschiebe bestehend, liegen auf der Oberfläche des grauen Emschermergels, der wasserundurchlässig ist. So kommt es, daß das Grundwasser innerhalb der Steinsohlen, die häufiger als Fließsand ausgebildet sind, zirkuliert und bisweilen an den Hängen der Hügel in Gestalt von Quellen austritt.
Dies sind die erdgeschichtlichen Grundbedingungen, die dieses Gebiet zu einem uralten Siedlungsgebiet werden ließen. Ohne Lößbedeckung und viele Quellen wäre es das nicht geworden. So wurden unbeabsichtigt durch Erdgeschichtliche Vorgänge für den völlig unbeteiligten Menschen die notwendigen Voraussetzungen für sein Dasein geschaffen. Der vorzeitliche Mensch suchte sie und fand sie auf der Hauptterrasse. Hier ließ sich leben, und hier und an den Abhängen baute er seine Siedlungen vor mindestens 4300 Jahren. Von diesen Siedlungen war oberflächig in der Gegenwart längst nichts mehr zu sehen. Reste davon aber schlummerten im Boden. Sie mußten erst erforscht und gefunden werden. Ein solcher Fund wurde 1938 im Bochumer Raum gemacht, als Auf dem Knust in Bochum-Kirchharpen eine moderne Siedlung gebaut wurde. Bei dieser Gelegenheit erschienen in den Hausfundamentgruben mit dunklen Füllmassen versehene Gruben, in denen sich jungsteinzeitliche Tongefäßreste, von Herdfeuern angeglühte Steine, sowie Teile von einfachen Getreidequetschsteinen fanden, die von Pastor Leich in Kirchharpen beobachtet und geborgen wurden. Damit war die erste jungsteinzeitliche Siedlung im Lößgebiet von Bochum entdeckt. Spätere Beobachtungen bis 1951 haben ergeben, daß diese vor-zeitliche Siedlung bis hinunter zur Lütkendorpstraße reichte, also sehr groß war (rund 50 ha). Etwas später kamen ganz ähnliche Funde und Befunde in der Ziegeleigrube des Harpener Ringofens zum Vorschein. Ende 1939 wurden Museumsdirektor Kleff von aufmerksamen Arbeitern gleiche Befunde in der Ziegelei Wintermann in Bochum-Altenbochum gemeldet, worauf das Landesmuseum Münster eine Ausgrabung ansetzte. Außer in der Ziegelei Harpener Ringofen (Becker) am Castroper Hellweg, wurden gleichalterige Siedlungsspuren 1940 in der Ziegeleigrube an der Meesmannstraße in Bochum-Riemke festgestellt. Offensichtlich lag auch beim Amtshaus in Bochum-Gerthe eine ähnliche vorzeitliche Siedlung, deren verlagerte Kulturschicht fast am Fuße eines flachen Hügels, einem Bachtal zu, zuerst von Bürgermeister i. R. Ibing 1949 beobachtet und von mir begutachtet werden konnte. Inzwischen sind in Bochum-Harpen noch zwei jungsteinzeitliche Siedlungen und in Bochum-Hiltrop „Im Güstenberge“ am Hof Benking durch Probegrabung im März 1951 noch eine Siedlung erschlossen worden. Auf Grund der an sich noch geringen Funde bin ich davon überzeugt, daß in jedem Falle entweder bandkeramische oder Fundstellen der Rössener Kultur vorliegen.
Es lagen nach diesen älteren Befunden vielfältige Anzeichen von sehr alten Siedlungen auf der Hauptterrasse in Bochum vor. Es galt nur noch, eine ausgrabungsfähige Siedlung dieser Art aufzufinden und deren Ausgrabung durchzusetzen. Ich weiß nicht mehr, wie häufig ich das genannte Lößgebiet abgewandert habe, um eine solche Siedlung zu finden. Der Gedanke aber, daß eine zu finden sein müsse, beherrschte mich stets. Meine engsten Mitarbeiter wissen darum. Als nun die Gewerkschaft Ver. Constantin der Große dazu überging, auf dem langgestreckten Lößlehmhügel im Straßendreieck Hiltroper–Bergener Straße einen weiteren Bauabschnitt ihrer großen Bergmannssiedlung in Angriff zu nehmen, entstanden lange und breite Straßenfundamente, die durchschnittlich bis 60 cm tief in den Untergrund reichten; tief genug, um vorgeschichtliche Siedlungsreste er-kennen zu können. Das sollte sich sehr bald bestätigen.
Am 2. Juli 1949 betrat ich von der Hiltroper Straße aus schon ausgehobene Fundamente zu der neuen Straße, die den Lößhügel ungefähr von Süden nach Norden überschneidet (Eifelstraße). Gleich am Anfang hoben sich deutlich vom Boden des Straßenfundaments einige dunkel verfärbte rundliche Stellen ab, die sich bei näherem Zusehen als angefüllte Gruben zu erkennen gaben. Ganz offensichtlich befanden sich hier in alter Zeit in den Lößlehmuntergrund eingetiefte Gruben, die später wieder zugefüllt worden waren. Die Füllmasse war dunkel-braun, stellenweise ein wenig schwärzlich, aber sehr fest, fester jedenfalls als die Umgebung, also der „gewachsene“ Boden. Unregelmäßig verstreut lagen in der dunklen Füllmasse kleine Bröckchen von Tongefäßresten, rotgebrannter Lehm und manchmal viele kleine Holzkohlen. Es bestand kein Zweifel mehr, daß es sich um Siedlungsgruben aus vorgeschichtlicher Zeit handelte. Am selben Tage meldete ich die Entdeckung dem stellv. Staatlichen Vertrauensmann für vor- und frühgeschichtliche Bodenaltertümer für den Regierungsbezirk Arnsberg, Dr. Beck. Dieser erschien am 9. Juli 1949. Gemeinsam stellten wir fest, daß die Gruben dem bandkeramischen Kulturkreis der jüngeren Steinzeit angehörten, da uns beim Ankratzen einer Grube sofort typische Tongefäßreste dieser Zeit in die Hände fielen. Es wurde eine sofortige Ausgrabung der vorgefundenen Gruben geplant. Von Prof. Stieren wurde ich als örtlicher Ausgrabungsleiter bestellt. Sofort nahm ich mit dem Heimatverein Bochum über seinen Vorsitzenden Max Ibing Verbindung auf, der wiederum die Stadt Bochum informierte und die erste Finanzierung der Ausgrabung in die Wege leitete. Die Stadtverwaltung Herne stellte mich und zeitweise zwei Spezialarbeiter für diese Arbeiten ab. Unterstützung fanden wir auch durch Bergwerksdirektor Dr. Heidemann sowie durch die Baumeister Diehl und Grennebach von der Gewerkschaft Constantin der Große. So konnten wir am 11. Juli 1949 mit der sachgerechten Ausgrabung beginnen. An diesem Tage ahnte keiner der Beteiligten, was sich alles vor unseren Augen im Erdboden ausbreiten würde. Wir machten Entdeckungen, die zum dauernden Bestandteil der Gesamtsied-lungsforschung weit über den westfälischen Raum gehören. Zunächst war es notwendig, den Boden des Straßenfundamentes vollständig zu planieren, so glatt, daß sich jeder Eingriff in den gewachsenen gelblichen Lößlehm auf der Oberfläche zeigen mußte. So faßten wir hier allein 12 Gruben, deren größte in 80 cm Tiefe noch 5 m lang, 3,70 m breit bei einer Gesamttiefe von 1,80 m groß war. Ohne Unterbrechung haben wir in der Siedlung Bochum-Hiltrop bis zum 15. Oktober 1949 ausgegraben. Zusätzlich gruben wir dann noch vom 27. Oktober bis zum 9. November 1949 auf dem Acker des Rechtsanwalts Koch östlich der Bergener Straße, wenig südlich der Kapelle. Insgesamt wurden 86 Gruben angetroffen und jede sachgerecht bearbeitet. Bei der Bearbeitung der Gruben halfen mir die Hauptfachprähistoriker Karl-Heinz Brandt und Frau Dr. Hanni Brandt-Peters. Beide haben mit größter Sorgfalt Gruben und Schnitte davon farbig gezeichnet. Frau Brandt-Peters übernahm sodann das Abzeichnen der besseren Scherben; es wurden 20 Tafeln. Weitere Tafeln mit Scherben zeichnete das Landesmuseum (Herr Teufel). Von den übrigen Mitarbeitern nenne ich besonders die Studierenden Süß und Kerstling von der Universität Münster. Schwierige Partien der Ausgrabung, wie z. B. die Grundrisse der Bauten, wurden unter Mithilfe von Prof. Stieren und seiner Assistenten, namentlich von W. Winkelmann, bearbeitet.
Die vorgefundenen Grubentypen
Es ist im Rahmen dieses Aufsatzes unmöglich, auch nur einen Teil der Gruben zu beschreiben. Ich muß mich darauf beschränken, zusammenfassend einiges darüber zu berichten. Die vorgefundenen 86 Gruben ließen sich ohne weiteres in 13 Typen unterteilen. Am häufigsten waren die einfachen ovalen Gruben mit rundlichem Boden vertreten (Typ 1). Die Typen 5 und 6 hatten je einen deutlichen, durch entsprechende Bodenverfärbung erkenn-baren Zugang, der bis 60 cm breit. schräg nach unten zu den eigentlichen Gruben führte. Gruben dieser Art waren stets als solche mit einer Feuerstelle erkennbar, wie kompakt liegende Holzkohlenlagen sowie Stücke rotgebrannten Lößlehms bewiesen. Wir glauben, diese Gruben als Herdgruben bezeichnen zu können, zumal sich in ihnen die meisten Reste von Tongefäßen fanden, von denen manchmal ein Teil im Feuer sehr stark,
fast bis, zur Sinterung, gebrannt waren. Daraus ist zu schließen, daß die Tongefäße zerbrachen, als die Feuer noch brannten. Zum Typ 4 gehörten Doppelgruben mit je einem Eingang. Jede Einzelgrube von ihnen war rundlich. Eine davon enthielt immer Holzkohlen, manchmal in starken Lagen, während die andere höchstens im Bereich der mit Holzkohlen angereicherten Grube geringe Holzkohlenvorkommen aufwies, die offensichtlich aus der ersten stammten. Rotgebrannter Lehm von der Unterlage der Feuerstellen fand sich am häufigsten und in teils großen Brocken in den Gruben mit Holzkohlenanreicherungen. Nach diesen Befunden zu urteilen, bestand die Doppelgrube aus einer Herdstellengrube und aus einer davor liegenden Hantierungsgrube (Küchengrube). Durch eine hohe Lößlehmschwelle waren beide Gruben manchmal voneinander getrennt Die Herdstellengrube war meist etwas kleiner und besaß steilere Wände. Der schräg nach unten führende ausgetretene Zugang mündete stets in die Küchengrube. Das weist darauf hin, daß wir in der zweiten Grube tatsächlich die Herd-
stellengrube zu sehen haben, die allein von der Küchengrube aus erreicht werden konnte. Den größten Durchmesser und die größte Tiefe hatten die runden Gruben (Typ 3); durchschnittlich 8 m Durchmesser, in 50 cm Planumtiefe. Sie reichten bis 2 m tief in den Untergrund.
Charakteristisch dafür war eine Grube (Nr. 25) im Nordteil der Siedlung, genau vor dem Eingang des heutigen Konsumgeschäftes an der Ecke Eifel- und Westerwaldstraße. Ihr Eingang lag im nordwestlichen Teil. Ursprünglich scheint diese Grube nicht ganz den großen Durchmesser gehabt zu haben, denn in der Einfüllmasse lagen dicke und lange Teile der abgestürzten Grubenwand. Wie bei fast allen Gruben hat auch zur Zeit der bandkeramischen Siedler Wasser in dieser Grube gestanden, wie eindeutig an der Schichtung der Füllung zu sehen war. Durch das Wasser sind Teile der Grubenwand abgebrochen und in die Grube gestürzt. In der Mitte des Grubenbodens stand ein größerer unzerstörter Lehmklotz. Man sah deutlich, daß er bei Benutzung der Grube ein Hindernis gewesen war, denn die Begangspuren (schmale schwachmuldenförmige Gänge auf dem Grubenboden) führten um ihn herum. Wir vermuteten gleich, daß in dem Lehmklotz ein Holzpfosten gestanden habe könnte, der als Stütze eines Daches über der Grube gedient haben dürfte. Deswegen schabten wir ihn von oben vorsichtig ab. Es erschien tatsächlich ein zugeschwemmtes Pfostenloch, das an seiner kreisrunden Form und dunklen Füllung kenntlich war.
Der Durchmesser betrug 50 cm. Rings um die Grube konnten wir keine Pfostenlöcher bemerken, auch nicht an den übrigen 85 Gruben. Gruben dieser Art wie Nr. 25 haben wir 1950 und 1951 auch in ähnlichen Siedlungen in Bochum-Harpen (Harpener Ringofen und Katholikentagsiedlung) angetroffen; es ist somit ein eigener Grubentyp.
Auf dem Boden der Grube fanden sich dicke Lagen von verbranntem Eichenholz mit Scherben von Tongefäßen. Letztere kamen am meisten südlich des erwähnten Lehmklotzes vor. Hier lagen vermischt mit vielen Holzkohlen nur wenige, aber zum Teil außerordentlich gute Scherben, die von dem Hochstand der frühesten Töpferei Kunde geben. Darunter ist z. B. ein größerer Scherben aus ganz fein geschlemmtem Ton, dessen Oberfläche in schwärzlichbrauner Farbe fast glänzend poliert worden ist. In die Außenfläche wurde ein reich verziertes Muster eingeritzt oder eingedrückt, das sich um einen Griffknubben aus Ton gruppiert. Leider wurde ein nicht weniger schön gearbeitetes Tongefäß schon zerbrochen vorgefunden. Danach ist anzunehmen, daß die zum Teil großen Scherben in das Herdfeuer gelangten und noch einmal bis zur Versinterungsgrenze reduzierend gebrannt wurden, wobei der Ton hellgrau und sehr mürbe wurde. Große und kleine Stücke von rotgebranntem Lößlehm fanden sich meist lagenweise in der Füllung. Diese Art des Vorkommens erklärt sich aus der Sortierung und nachgefolgten Schichtung durch Regenwasser, das nach Verlassen der Grube darin gestanden haben muß. Reste von Getreidequetschen, zum Teil mit Schliffspuren, fanden sich ebenfalls in der Grube Nr. 25, sowie ein flaches Grauwackengeröll, das wahrscheinlich zum Anreiben von mineralischen Farbenpulvern diente. Ein solches Farbenmineral, und zwar stark angeschabte Stücke von Roteisenstein (Hämatit) ist mehrfach gefunden worden, aber nur hier im Nordteil der Siedlung. Das mit Feuersteinmessern abgeschabte rötliche Farbpulver wurde wahrscheinlich auf kleineren Steinplatten mit Tierfett angerührt; in der Literatur wird hierüber von Farb-schminkplatten berichtet. Möglicherweise haben sich die Schönen der bandkeramischen Siedler auch schon geschminkt. Es ergaben sich zweifellos aber noch andere Verwendungszwecke für diese Farbe. So fanden sich in der Grube Nr.58 verzierte Scherben, in deren Einritzungen Spuren einer roten Farbpaste sichtbar waren. Aus den verschiedensten vorgeschichtlichen Kulturen ist bekannt, daß vertieft angebrachte Verzierungen an Tongefäßen mit weißen Farbpasten ausgeschmiert wurden, damit sie kontrastreicher in Erscheinung traten. In der Grube Nr. 2 fanden wir einen Scherben mit weißausgelegten Verzierungen. In etwas jüngeren Siedlungen bei Heilbronn (Großgartach) fand sich sogar ein mit 1 cm breiten roten und weißen Streifen im Zickzackmuster verzierter Lehmverputz von Flechtwerkhüttenwänden.
Die vorgefundenen Tongefäße und Steinwerkzeuge
In den meisten Gruben fanden sich T o n g e f ä ß s c h e r b e n , die in der Hauptsache von täglichen und daher unverziertem Gebrauchsgeschirr stammen. Größere Gefäße besaßen an den Außenwänden zwei oder drei aus den Gefäßwandungen herausgeknetete Griffknubben verschiedener Formen oder auch Henkelösen. Regelrechte Henkel wurden nicht beobachtet. Meist war dem Ton feinzerschlagener Steinchengruß beigemengt. Gebrannt wurden die zunächst lufttrockenen Tongefäße bis zu einem mittelharten Grad. Bei Kochtöpfen – von ihnen stammen wahrscheinlich die meisten Scherben – war ein stärkerer Brand nicht nötig, weil sie auf dem offenen Herdfeuer von selbst hart gebrannt wurden. Sämtliche Gefäße besaßen einen kugeligen Boden und wiesen keine Standfläche auf. Das ist in den Anfängen der Töpferei überall in Europa und darüber hinaus so gewesen. Erst später erscheinen flache Standböden (z. B. in der Rössener Kultur). Man sieht es den bandkeramischen Tongefäßen an, daß sie aus Frauenhänden hervorgingen. Am besten ist dies an Verzierungsmotiven zu er-kennen, die mit den Fingernägeln gemacht worden sind. Ihre Zierlichkeit verrät Frauenhände. Man glaubt heute allgemein, daß die Erfindung der Töpferei eine Kulturtat der Frauen ist. Hierher gehören auch das Spinnen und Weben, wovon bei den Bochumer Ausgrabungen kein Nachweis gelang, die aber in der Bandkeramik schon bekannt waren.
Es waren zweifellos intelligente Frauen, die auf unserem Fundplatz die Töpferei betrieben. Dies verrät der außerordentlich große Variationsreichtum der vorgefundenen Gefäß- und Verzierungsformen. Es gibt unter den vielen verzierten Scherben kaum einen, der mit einem anderen übereinstimmt. Der fraulichen Phantasie waren scheinbar keine Grenzen gesetzt. Da laufen kühnen Bogen rings um die Gefäßaußenwandung je zwei zusammen-gehörende Wellenbänder,die mit großer Sicherheit und bewunderungswürdiger Symmetrie eingeritzt worden sind. Manchmal sind die kurzen Zwischenräume zwischen den beiden Bändern mit einem gestrichelten oder punktartig eingedrückten Muster ausgefüllt. Schon allein diese Verzierung an sich war meisterhaft. Aber damit nicht genug, auch die Zwischenräume unter den Bändern erhielten dezent angebrachte, einfache Verzierungen. Meist sind es vier oder sechs kurze Ritzlinien, die fast waagerecht angebracht wurden und deren Enden mit einem Eindruck oder Kurzsenkrechtstrich begrenzt wurden. Dicht unter dem steilen Mündungsrand verlaufen sodann noch ein- oder zweireihige Einstiche mit geringem Abstand voneinander. Denken wir uns nun noch die sauber gekneteten Griffknubben und die farbig ausgelegten Verzierungen hinzu, so will es uns scheinen, daß die meisten Tongefäße auch nach heutigen Begriffen zum Kunsthandwerk gerechnet werden dürfen.
Nach den bandartig umlaufenden Verzierungen wird die ganze damalige Kultur als die der Bandkeramiker benannt. Weil wir die Träger dieser Kultur, ihre Volkszugehörigkeit noch nicht kennen, deswegen wählte man diese neutrale Bezeichnung. Man spricht in der wissenschaftlichen Literatur, und zwar nach dem Herkommen dieser Kultur aus dem mittleren Donauraum, darunter auch Böhmen und Mähren, aber auch bereits von der Donauländischen Kultur. Die Menschen dieser Kultur waren. Ackerbauer und Viehzüchter. Deswegen bevorzugten sie Lößböden wie in Bochum-Hiltrop. Hier gelang es Prof. Dr. H. Budde (Plettenberg) in einer Grubenprobe, die wir ihm zur Analyse zusandten, Weizen- und Gerstenanbau nachzuweisen. Brotreste aus grobgeschrotetem Gersten- und Weizenmehl konnten ebenfalls festgestellt werden. Vom Knust in Bochum-Kirchharpen, einer Siedlung, die zur jüngsten Untergruppe der Bandkeramik gehört (Rössener Kultur), gelang uns schon vor Jahren der Nachweis von Weizenanbau sowie die Haltung von Rindern.
Bei den neuesten Bochumer Ausgrabungen wurden auch S t e i n w e r k g e z e u g e gefunden. Da sind zunächst scharfschneidende Messerchen sowie Bruchstücke von solchen in Zeigefingergröße zu erwähnen. Dies waren die einzigen Schneidegeräte der Siedler. Man kann sich schwer vorstellen, daß sie mit diesen kleinen Messern die vorkommenden Schneidearbeiten ausgeführt haben. Es muß aber wohl so gewesen sein, denn auch anderswo sind kaum größere Feuersteinmesser gefunden worden. Klingenförmige Feuersteine besitzen an einem Ende eine rundliche Stirn zum Schaben. Nur ein einziger regelrechter Bohrer aus Feuerstein wurde vorgefunden. Ein Teil des verwendeten Feuersteins, der zum Teil von den Siedlern zu Werkzeugen bearbeitet worden ist, stammt mit Sicherheit aus dem belgisch-holländisch-limburgischen Raum, wo vorzeitliche Siedlungen der Art wie in Bochum-Hiltrop ebenfalls bekannt sind. Nehmen wir nun auch noch die größeren Werkzeuge aus Felsgestein hinzu, die durch entsprechende Behauung in die vorbedachte Form gebracht, dann geschliffen und zum Teil noch poliert wurden, so erkennen wir das verwendete Rohmaterial als aus den mittelrheinischen Gebirgen stammend (Taunus, Spessart, Odenwald). Ein vorgefundener 10 cm langer, 1,3 cm breiter und 1,4 cm hoher Rillenzieher (allgemein Schulleistenkeilchen genannt) aus dunkelgrünem, schwarz gestipptem Gestein ist aus Ampbibolith (Hornblendeschiefer) angefertigt. Dieses Material ist in Westfalen unbekannt und dürfte aus den genannten rheinischen Gebirgen stammen. Das gilt auch für eine kleine flache Breithacke aus streifigem Diabas (Grünstein). Mir ist aus Westfalen nur der Diabasmandelstein bekannt, der sich in der Struktur vollkommen von dem Streifendiabas unterscheidet. Die Herkunft des verwendeten Steinmaterials könnte ein Beweis dafür sein, daß unsere Bochumer Siedler vom Rhein her zu uns kamen. Auch dort, z. B. in Köln-Lindenthal, ist eine gleichartige bandkeramische Siedlung erschlossen worden. Möglicherweise hatten unsere Siedler von Bochum-Hiltrop Beziehungen zu den westlichen Stammesgenossen. Vielleicht bildete man untereinander in dem Großraum Belgien (Hesbaye), Südholland, Mittel-Niederrhein und Ruhrgebiet eine in sich geschlossene volkliche Einheit. Es erscheint jedenfalls undenkbar, daß ein so kulturell fortgeschrittenes Volk wie die Bandkeramiker wahllos und versteut und ohne staatliche Bindungen sich über Europa verbreitete. Unter dem in Bochum-Hiltrop geborgenen Kulturgut gibt es viele Übereinstimmungen mit dem Kulturgut aus dem genannten Großraum, daß sich der Gedanke an eine volkliche Einheit förmlich aufdrängt. Ein Nomadenvolk waren die Bandkeramiker zweifellos nicht. Es wird sich um ein seßhaftes Bauernvolk gehandelt haben, denn ihre Kultur und Wirtschaftsweise war schon hoch entwickelt. Das beweisen auch die Befunde in der Anlage der Siedlungen.
Die vorgefundenen Bautypen
Als wir am Südhang des Lößlehmhügels in der unteren Eifelstraße ausgruben, ging unser Blick häufiger hinauf zum Hügelscheitel, denn aus anderen Befunden wußten wir, daß, wenn überhaupt Grundrisse von großen Gebäuden zu finden waren, dann nur dort auf der Höhe an der Westerwaldstraße. Besonders diese Geländestelle ließen wir nicht aus den Augen, und als das Bochumer Wasserwerk in der südlichen Bürgersteigseite der Westerwaldstraße einen schmalen Graben für die Wasserrohre aushob, erschienen im Schnitt, säuberlich nebeneinander in einer Reihe Pfostenlöcher. Wir gingen ihnen nach und fanden den Südteil eines Gebäudegrund-risses, dessen nördlicher Teil leider schon unter der mit Packlage belegten Westerwaldstraße lag. Gegenüber, also nördlich, fanden wir dann das Nordende des Grundrisses in wünschenswerter Klarheit. Um ganz sicher zu gehen, haben wir Teile der Packlage abgehoben und dabei eindeutig feststellen können, daß beide Grundrißteile zusammengehörten. Wir konnten ein Gebäude nachweisen, das die respektable Länge von 17,50 m und fast 8 m Breite aufgewiesen hatte. Wir ahnten nicht, daß uns sehr bald ein noch größeres Glück beschieden war. Streifenweise haben wir das Geländedreieck Westerwald-Eifelstraße, wo sich heute der Constantinkonsum mit den Kinderspielplätzen befindet, abgedeckt. An der Ostseite deckten wir einen Streifen ab, rund 6m westlich vom ersten Gebäudegrundriß. Zunächst erschienen in einer Linie hintereinander drei Gruben, ebenso hintereinanderliegend, wie 14 m westlicher im östlichen Bürgersteig der Eifelstraße die Gruben Nr. 21 bis 25. Unsere Vermutung, daß die Ausrichtung der Gruben in einer Linie, fast von Norden nach Süden mit einem Hindernis zusammenhängen könne, das die Grubenanordnung verursachte, bestätigte sich bald, denn es erschienen auf der Oberfläche des östlichsten Planums säuberlich hintereinander je ein Doppelpaar Pfostenlöcher, schnurgerade ausgerichtet. Wir hatten den zweiten Gebäudegrundriß gefaßt! An jenem denkwürdigen Tage, es war Mitte August, arbeiteten wir mit 12 Leuten bis zum Anbruch der Dunkelheit, um möglichst das Ende der Pfostenlochdoppelreihe zu erreichen. Diese ging plötzlich in eine streifenförmige Bodenverfärbung über, genau so wie am Nordende des ersten Grundrisses. So wünschten wir uns den Verlauf der Ausgrabung und als nun auch noch der Streifen (Fundamentgräbchen mit Pfostenlöchern) scharf nach Westen umbog und hier der Verlauf der Bodenverfärbungen weiterging, wußten wir mit Bestimmtheit, daß ein langer Gebäudegrundriß vorlag. In der Folgezeit haben wir dann trotz mancher Schwierigkeiten bis auf ganz wenige Pfostenlöcher den gesamten Grundriß in einer Klarheit und Vollständigkeit herausgearbeitet, wie es bisher bei anderen Ausgrabungen in gleichartigen Siedlungen selten möglich war. Da lag nun der 28 m lange und 8 m breite Grundriß vollständig vor uns, ein Ausgrabungsresultat, wie es selten Ausgräbern zuteil wird.
Im weiteren Verlauf der Ausgrabung gingen wir nach Osten über den ersten Gebäudegrundriß hinaus und faßten hier neben einigen wichtigen Gruben den Grundriß eines kleinen Gebäudes mit den Maßen 8x3,50 m. Bei Be-trachtung des abgebildeten Planes drängt sich uns die Annahme auf, daß die drei Gebäude einstmals als ein geschlossenes Gehöft zusammengehört haben müssen. Alle anderen Ansichten, der längste Bau könne ein Männer- oder Versammlungshaus gewesen sein, erscheinen demgegenüber als kaum beweisbar. Zu diesem Gehöft gehörten sicherlich auch die zahlreichen Gruben, die wir in seinem Bereich antrafen. Darunter waren nicht wenige, die wegen ihres reichen Holzkohlengehaltes als Herdgruben angesprochen werden können, an der Westseite des 28 m langen Gebäudes die Gruben 21 bis 25. Letztere haben wir geradezu. als Kochhütte angesprochen, weil das Pfostenloch in der Mitte auf eine Mittelstütze einer Bedachung über diese Grube deutet. Unterstrichen werden muß, daß sich die zuletzt genannten Gruben bis in rund 2 ½ m Entfernung entlang der Westwand des 28 m langen Gebäudes befanden und eben dieses Gebäude gerade hier die genannte Grubenanlage vorschrieb. Daraus ist zu schließen, daß sie zu dem Gebäude gehören dürften. Das wird wahrscheinlicher, wenn wir noch erfahren, daß sich auf dem Boden des langen Gebäudes keine Herdstelle oder sonst eine Grube befunden hat, wohl aber in dem 17,50 m langen Bau nebenan (östlich). Da in letzterem Bau eine Herdstelle angetroffen wurde, hatten wir eine solche auch theoretisch im längsten Bau auffinden müssen, falls eine solche vorhanden war. Gewiß kann man sagen, der Boden sei mit einem Lehmestrich oder mit einem Balkenboden mit Lehmestrich darauf belegt gewesen, worauf eine mit Steinen und Lehm aufgebaute Herdstelle gelegen haben könne. Da dieser Estrich hoch lag, auf der damaligen Hügeloberfläche, sei von ihm und damit von der Herdstelle nichts mehr nachweisbar. Diesem Beweisführungsversuch halten wir entgegen, daß im 17,50 m langen Bau kein Estrich mit Herdstelle darauf vorhanden gewesen sein kann, denn wir fanden, wie erwähnt, die eingetiefte Herdgrube. Für mich ist es eindeutig, daß die Gruben 21 bis 25 infolge ihrer Beschaffenheit Herdstellen der Bewohner des 28 m langen Baues waren und darum in diesem keine Herdstellen nachweisbar gewesen sind. Warum diese nun darin nicht angelegt worden sind, können wir nur vermuten. Vielleicht waren Herdfeuer der Sicherheit des aus Baumstämmen erbauten und mit Strohdach versehenen Gebäudes gefährlich, schon allein wegen des Funkenflugs, zumal wir uns die Außenwände nur etwa 2,50 m hoch zu denken haben. Denkbar ist auch, daß der Verwendungszweck des Baues Herdfeuer ausschloß. Warum aber befand sich im ersten Bau eine Feuerstelle? Er war doch ebenso gefährdet. Restlos lassen sich die Zusammenhänge noch nicht lösen.
So kommen wir nun auf den Oberbau der beiden Gebäude zu sprechen. Wir müssen ihn aus den Grundrissen zu erkennen suchen und Vergleichsbefunde heranziehen. Beide Gebäude hatten Doppelpfostenwände, auch an den Nordenden. Je zwei Pfosten standen durchschnittlich 20 cm auseinander. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Doppelpfostenreihen außerordentlich gerade standen, also genau fluchteten, wie aus den Grund-rissen zu ersehen ist. Aus der Doppelheit der Senkrechtpfosten, ihres ziemlich gleichen Abstandes und der Geradheit der Doppelreiben, schließen wir auf Baumstammwände, bei denen Stamm über Stamm waagerecht gelegt worden ist. Ein Ausweichen derselben nach den Seiten verhinderten die Dopppelreihen von Senkrechtpfosten. Dies war die Hauptaufgabe der letzteren. Da jedoch die innere Reihe der Senkrechtpfosten etwas tiefer eingegraben war als die äußere, glauben wir, daß diese innere Senkrechtpfostenreihe noch eine tragende oder stützende Aufgabe hatte, um den Traufrand des Satteldaches abzustützen. Möglich ist, daß die Innenfläche der Baumstammwand mit Lehm beworfen und verschmiert worden ist. Ritze konnten mit Moos zugestopft werden. So denken wir uns die Wiedererstellung des Oberbaues der beiden Grundrisse. Nun haben wir uns noch den Nordenden der beiden Gebäude zuzuwenden. An den Längswänden ging die Baumstammwand durch, den hier haben wir ebenfalls die Doppelreihe Pfostenlöcher, aber die innere Reihe liegt in einem schmalen Fundamentgräbchen, das allein die nördliche Schmalwand einnimmt. Wie ist dieser ganz eindeutig gemachte Befund zu erklären?
In dem Fundamentgräbchen dürfte Baumstamm (Pfosten) neben Baumstamm gestanden haben, so daß hier eine Art Palisadenwand an der inneren Seite der waagerechten Baumstammwand stand, die an der Nordschmalwand diese allein bildete. Diese Doppelwände dürften zur Verstärkung dieses Teiles der Gebäude gedient haben (Winddruck) und zum Kälteschutz. Daß in den Fundamentgräbchen dicht nebeneinander Pfosten standen, ergaben Längsschnitte, wobei fast ausschließlich nur diejenigen nachgewiesen werden konnten, die tiefer eingegraben waren und durch die Sohle der Fundamentgräbchen hindurchgingen, jedenfalls deswegen, weil sie zu lang waren. Die drei Reihen Pfostenlöcher im Inneren der Grundrisse stammen von „Ständerreihen“, die das schwere Satteldach trugen. Die „Stände“ waren tiefer eingegraben als die Pfosten der Außenwände, wohl ein Beweis, daß sie hauptsächlich eine tragende Aufgabe hatten. Im Nord- und Südteil der Gebäude standen sie dichter, wohl deswegen, weil die Enden der Gebäude durch Winddruck am meisten gefährdet waren. Für die Erbauer war es leicht, die „Ständer“ zur Querteilung des Gebäudeinneren zu benutzen, indem sie sie als Stützen für leichte, eingebaute Querwände mit Türöffnungen ausnutzten. Eine Unterteilung des längsten Baues in verschiedene Gemächer dürfen wir sicherlich annehmen.
Der kleinste stallartige Bau war nur rund 8x3,50 m groß. Die Wände wurden von nur einer Pfostenreihe gebildet. Zwischen den einzelnen Pfosten mag eine Flechtwerkwand mit beiderseitigem Lehmbewurf gestanden haben. Das Dach dürfen wir uns wohl ebenfalls als Satteldach vorstellen. Gleiche Pfostenstellungen in anderen Siedlungen dieser Kultur wurden als hochgelegene Speicheranlagen gedeutet, dem wir uns in unserem Falle nicht anschließen können.
Diese Bauten können wir nicht verlassen, ohne einige Betrachtungen anzuknüpfen. Vor mindestens 4300 Jahren errichteten die Siedler hier auf der Höhe von Bochum-Hiltrop bis 28 m lange Bauten, die bis in unsere Zeit hinein nicht nur von einem riesigen Aufwand an Arbeit zeugen, sondern auch von dem großen baulichen Können dieser ältesten Bauer. Allein für die Erbauung des längsten Gebäudes waren rund 120 senkrecht gestandene Pfosten notwendig (ohne die für die nördliche Palisadenwand), die durchweg 20 cm Durchmesser aufwiesen, wie wir aus verschiedentlich angetroffenen Standspuren innerhalb einiger Pfostenlöcher schließen dürfen. Die Zahl der waagerecht gelegenen Baumstämme können wir nur unsicher errechnen, weil wir ihre Länge nicht kennen. 300 Baumstämme waren es sicherlich. Diese Vielzahl an Stämmen mußte mit einfachen Steinbeilen gefällt wer-
den, eine mühselige Arbeit. Durch Holzkohlen aus den Gruben konnten bisher Eich- und Eschenbäume (gemeine Esche Exelsior fraxinus) als damalige Waldbäume festgestellt werden. Es muß damals auch eine Art Bauleitung
gegeben haben, denn eine leitende Stelle muß die vielen symmetrisch angeordneten Pfostenlöcher abgesteckt, überhaupt den Bauplan entworfen haben, einen Bauplan, den der Baumeister vielleicht nur gedanklich mit
sich herumtrug, denn aufgezeichnet wird er ihn wohl nicht haben. Beachten wir nun noch die Leistungen der Siedler bezüglich ihrer keramischen Erzeugnisse, so kommt uns die Erkenntnis, daß diese Menschen wohl Stein-zeitmenschen waren, aber uns in geistiger Hinsicht viel näherstanden, als wir anzunehmen geneigt sind. Die Ausgrabungen in Bochum-Hiltrop haben nicht, wie einige Außenstehende befürchteten, wieder mal die Primitivität vorgeschichtlicher Kulturen ergeben, sondern das Gegenteil.
Ausgrabungen an der Bergener Straße
Eingangs haben wir schon bemerkt, daß wir in Landschaften mit einer bandkeramischen Siedlung mehrere in nächster Nähe liegend vermuten. Aus dieser Erwägung heraus haben wir schon während unserer Ausgrabungen die Umgebung nach Anzeichen von weiteren Siedlungen abgesucht. Dabei haben wir auf Grund jahrzehntelanger Geländeerfahrungen bestimmte Methoden entwickelt, die auch im Bochumer Gebiet, nicht versagten; es wird später einmal Gelegenheit sein, darüber zusammenfassend zu berichten. Zunächst lenkten wir unsere Blicke auf das flache Gelände nordöstlich der neuen Constantinsiedlung, sofort jenseits der Bergener Straße, wenig südlich der Kapelle. Wir vermuteten, daß sich die ausgegrabene Siedlung hier um den Quelltopf des Bergener Mühlenbaches fortsetzte und so eine viel längere Ausdehnung hatte, als es die bisherigen Ausgrabungen auswiesen. Sogar unmittelbar südwestlich vor der Zeche Constantin Schacht X scheinen Siedlungsreste vorzukommen. Ob hier eine selbständige oder das Nordwestende unserer Siedlung lag, müßte noch festgestellt werden.
Wir sind diesem Ziel 1951 anlässig einer weiteren Ausgrabung hier an der Bergener Straße näher gekommen, Die Stadtverwaltung Bochum stellte die Mittel zur Verfügung, vier bis 60 m lange Suchgräben in östlicher Richtung anzulegen. Hierbei ergab sich, daß eine in den Jahren 1949-50 angetroffene Fundament-gräbchenanlage, wovon weiter unten berichtet wird, am östlichen Rand der Hiltroper bandkeramischen Siedlung gelegen hat. Rund 15 m östlich dieser 56 m langen Fundamentgräbchenanlage wurde der Untergrund auffallend klar, hier war die Ostgrenze unserer dorfartigen Anläge, deren Westgrenze uns schon 1950 klar war. Somit war sie rund 260 m lang (entlang des Quellrinnsales, Westosterstreckung) und 200 m breit (den Hügel hinauf). Dieser Flächenraum ist von der Siedlung eingenommen worden; wir dürfen somit von einer dorfartigen Anlage berichten.
Vierzehn Tage vor Beginn unserer Probegrabung nordöstlich der Bergener Straße stand ich mit dem Vor-sitzenden des Bochumer Heimatvereins, Max Ibing, an dieser Stelle. Ich trug ihm meine Absicht vor, hier einige Suchgräben anzulegen. An einem Sonntag trafen wir uns bei dem Besitzer des Grundstückes, Rechtsanwalt Koch, der uns ohne weiteres die Erlaubnis dazu gab. Am 29. Oktober 1949 begannen wir. Einen Teil der Kosten dieser Ausgrabung trug die Altertumskommission von Westfalen. Schon im ersten Suchgraben erschienen Reste der braundunklen Kulturschicht, die uns starken Begang dieser Geländestelle in vorgeschichtlicher Zeit verriet. Da erschien im Suchgraben 2 ein schmales Gräbchen, das wir nach den Seiten hin weiter verfolgten. Wir faßten 10 m, 20 m, 30 m und schließlich 45 m! Bei dieser enormen Länge wurde es uns denn doch ein wenig „heiß“, denn ein Gräbchen dieser Länge war uns von nirgendwo bekannt. Also mußte Prof. Stieren her. Zunächst konnten wir nicht viel mit dem Befund anfangen. Die Standspur einer Palisadenwand, vielleicht ein Viehpferch? Um klarzukommen, legten wir einen Suchgraben weiter nach Nordosten an und stießen bei genau 11,20 m auf ein parallel verlaufendes Gräbchen in gleicher Ausbildung. Zu unserer Freude hielt dieses Parallelgräbchen stets 11,20 m Abstand vom südwestlich verlaufenden Gräbchen. Nur am Nordostende machte der zweite Schenkel einen schwachen Bogen nach außen, um nicht wieder in die ursprüngliche Fluchtlinie einzulenken.
Mittlerweile hatten wir die Gesamtlänge der beiden Gräbchen mit 56 m festgestellt, eine Rekordlänge! Da nun im November Frost einsetzte, mußten wir unsere Ausgrabung einstellen und auf das nächste Jahr verschieben. Wenn wir auf unserer Abbildung den Grundriß der Anlage auf dem Acker Koch betrachten, so sehen wir, daß die Gräbchen stellenweise aussetzen, dies verdanken wir dem Frost, der diese Partien zerfroren hat. Ursprünglich liefen die Gräbchen ohne die geringste Unterbrechung durchgehend durch, Im Sommer 1950 führten wir die zweite Ausgrabung an dieser Stelle durch. Diesmal ging es darum, evtl. vorhandene Verbindungsstücke des Gräbchens zwischen den beiden langen aufzufinden, denn wir vermuteten, daß die beiden langen ein gewaltiges Rechteck einschlossen. Da in nordwestlicher Richtung der Acker fast unmerklich abfiel, machten wir uns hier wenig Hoffnung, weil schon eine geringe Bodenschrägung genügt, im Verlaufe von Jahrtausenden einiges der Bodenoberfläche abschwemmen zu lassen, zumal auch die Schwerkraft auf abschüssigem Gelände eine Rolle dabei spielt. So fanden wir in der Hauptsiedlung in der Constantinsiedlung nur dort Reste der Kulturschicht, wo der Boden ganz plan lag. Wo er auch nur etwas abfiel, fand sie sich nicht, wohl aber in weiter Entfernung abgeschwemmt am Fuße solcher Abschrägungen des Hügels.
Spuren des Gräbchens am Nordwestende fanden sich in Gestalt von zwei Pfostenlöchern, die zufällig durch den Boden des Fundamentgräbchens hindurchgingen; wie wir noch sehen werden, muß von Fundamentgräbchen ge-sprochen werden. Erfolgreicher waren wir am Südostende der Langgräbchen. Zunächst fand sich auch hier nichts von einem verbindenden Gräbchen, so daß schon von der Aufgabe weiterer Untersuchungen gesprochen wurde. Damit war ich nicht einverstanden, und wir schabten unverdrossen gleich unter dem Humus beginnend Zentimeter um Zentimeter Lößlehm ab. Schließlich erschien ganz schwach eine schmale Bodenverfärbung, das konnte der verbindende Schmalschenkel sein. Wir ließen ihn einige Tage offenliegen und verständigten Prof. Stieren. Setzt man vorgeschichtliche Bodenverfärbungen bestimmte Zeit der Luft aus, so können sie sich intensiver verfärben und diesen Zeitpunkt gilt es abzupassen, weil danach das Gegenteil eintritt. Wir hatten tatsächlich das Verbindungsstück gefunden und daraus unsere Schlußfolgerungen zu ziehen; die Gräbchen umschlossen wirklich einen langrechteckigen Raum.
Danach konnte angenommen werden, daß die Fundamentgräbchen für Pfostenstellungen bestimmt waren, die Wände bildeten. Um das festzustellen, wurden durch die Gräbchen Querschnitte angelegt und dabei von uns allen manchmal sehr und manchmal weniger deutlich die dunkleren Standspuren von senkrecht gestandenen Holzpfosten bemerkt, die meist ungleichen Abstand voneinander hatten. Nur an den Nordwestenden beider Langgräbchen fanden sich, aneinanderstoßend je drei Pfostenstandspuren, die ich sowohl schwarzweiß als auch farbig photographieren konnte, um so jederzeit diesen wichtigen Befund vorweisen zu können. Auch die Herren Dr. Beck und Winkelmann vom Landesmuseum haben diese Pfostenstellung begutachtet. Die Verstärkung der Wände an den Enden durch drei anstoßende Pfosten kann nur den Zweck gehabt haben, ein Ausweichen der Wände nach der Nordwestseite zu verhindern; es dürften Verstärkungspfosten gewesen sein.
Es gilt, die Bauweise der Wände zu ermitteln. Dabei können wir an Flechtwerkwände und an Palisadenwände denken. Da wir nun nur im unregelmäßigen Abstand voneinanderstehende Pfostenstandspuren innerhalb des Fundamentgräbchens ermittelten, manchmal auch ganz dicht zusammenstehende, glaube ich, Palisadenwände annehmen zu müssen, von denen wir nur solche Standspuren sahen, die zufällig besonders dunkel verfärbt waren. Dabei ist der Begriff dunkel verfärbt durchaus relativ, denn häufiger geht diese Dunkelfärbung nur auf einen höheren Wassergehalt der Standspur gegenüber der Umgebung und umgekehrt zurück! Und dann, man muß Fundamentgräbchen, wenigstens einen großen Teil, immer als von Palisadenwänden stammend ansehen, weil diese Bauart dazu zwingt, durchgehende Gräbchen anzulegen, Flechtwerkwände jedoch nicht. Das ist doch logisch. Daß Fundamentgräbchen zwecks Querriegelanlegung am unteren Ende der Pfosten notwendig waren, erscheint mir unrichtig zu sein. Bei horizontal gelegten Baumstammwänden, wie an unseren beiden Großbauten in der Constantinsiedlung, dürften die untersten zwei bis drei Lagen eingegraben worden sein, aber nicht so tief, daß im gewachsenen Boden eine „Narbe“ zurückblieb. Unsere angenommen Palisadenwände können innen mit Lehm beworfen worden sein. Die Spa1ten zwischen manchen Senkrechtpfosten konnten auch mit Moos oder Heu zugestopft werden.
Wenn wir für unsere 56 m lange und 11,20 m breite Anlage den Grundriß eines Gebäudes annehmen wollen, so muß natürlich auch ein Dach vorhanden gewesen sein. Doch wir fanden im Innern nichts, was darauf hinweisen konnte. Wie bei den anderen beiden Großbauten mußten nach allen bisherigen Erfahrungen die Pfostenlöcher von Tragpfosten für das Dach nachweisbar gewesen sein. Das war, wie erwähnt, leider nicht der Fall. Dr. Paul Clemens, Museumsdorf Cloppenburg, hat sich studienhalber an unseren Ausgrabungen beteiligt, wie auch andere. Clemens hat daran gedacht, für das Dach Sparrenkonstruktion anzunehmen. Er sagt aber selbst, daß die Sparren dann unwahrscheinlich lang gewesen sein müßten. Immerhin ist das ein Lösungsversuch, denn Sparrendächer benötigen keine Tragständer. Vielleicht vertraten je zwei dünnere lange Baumstämme, die oben über kreuz gelegt wurden und so den Firstbalken, sowie die Horizontalbalken der Seitenpfetten aufnahmen, die Stelle der Tragpfosten, die so nicht eingegraben zu werden brauchten? Möglicherweise haben wir an unserem „Riesenbau“ eine leichte Dachkonstruktion anzunehmen?
In der großen polnischen Jahresschrift „ Wiadomosci Archeologiczne, Bulletin Archéologique Polonais“ Band XV, 1938, finde ich die Beschreibung einer bandkeramischen Siedlung (Kr. Wloclawek in Nordwestpolen) mit 39 trapezförmigen bis rund 40 m langen Grundrissen ähnlich der Art wie vom Grundstück Koch in Bochum-Hiltrop. Dicht zusammen, sich manchmal überschneidend fanden sich hier tiefgreifende Fundamentgräbchen, die einen großen trapezförmigen Innenraum umschlossen, der an einem Ende schmaler und im anderen Ende breiter war (2,50 bis 5 m an den Schmalenden und 5 bis 10 m an den Breitenden bei Grundrissen von 15 bis 39 m Länge). Wie erwähnt, hielt unser Rechteck in Bochum-Hiltrop an beiden Endpartien stets rund 11,20 m Abstand,verlief somit nicht trapezförmig wie die in Polen. Interessanterweise fanden sich am polnischen Fundort im Innenraum ebenfalls keine Pfostenlöcher! Also auch darin gleichen sie unserem Befund. Wie wir, so nehmen auch die polnischen Forscher an, daß in den Fundamentgräbchen dichtstehende Pfostenreihen gestanden hätten, wie sie aus verschiedenen Anzeichen schlössen. Über die Dachkonstruktion berichten sie nichts. Wohl erwähnen sie, daß diese langen Gebilde von ihnen als Wohnhäuser und zugleich als Wirtschaftsgebäude (Scheunen, Ställe, Speicher, Werkstätten in eins?) angesprochen würden. Dürfen wir gleiches nicht auch von unserem Grundriß auf dem Grundstück Koch annehmen? Vielleicht dürfen wir es, denn zu der uns schon bekannten ovalen Grube (3x1 m groß), rund 4 m von der östlichen Langwand unserer 56 m langen Anlage an der Bergener Straße entfernt, haben wir anlässig der weiteren Untersuchung 1951 noch eine charakteristische bandkeramische Grube angetroffen, eine sogenannte Kreisgrube (1,80x1,40 m). Wir haben also auch hier, wie an den sicheren Bauten-grundrissen im Westteil unserer Siedlungen Gruben liegen.
*
Wie dem auch sei, die Tatsache, daß unser Heimatgebiet schon in der frühen Jungsteinzeit besiedelt war, läßt sich an Hand der neuesten Bochumer Befunde nicht leugnen. Anscheinend haben wir es hier mit einer der ältesten Bauernsiedlungen des Ruhrgebiets überhaupt zu tun, die bereits dorfartig angelegt war. Menschen der jüngeren Linearbandkeramik aus dem dritten Jahrtausend vor Christi müssen es gewesen sein, die auf dem langgestreckten Hügel in Bochum-Hiltrop diese Siedlung errichteten. Gleichzeitig oder wenig später kamen anscheinend ebenfalls vom Niederrhein her Siedler der Rössener Kultur, deren Verwandschaft (Tochterkultur) mit dem bandkeramischen Kulturkreis nachgewiesen ist, in das Ruhrgebiet. Diese Untergruppe der bandkeramischen Kultur ist nach dem Gräberfeld (Bestattungen unter der Erde) in Rössen, Kreis Merseburg, benannt worden. Sie schließt bei uns die Besiedlung des bandkeramischen Kreises ab. In Bochum-Hiltrop sind nur ganz wenige Scherben aufgefunden worden, die, wenn sie nicht der Rössener Kultur angehören, so doch wohl von ihr beeinflußt sind. Ausgesprochene Siedlungen der Rössener Kultur haben wir mit Sicherheit auf dem Gelände Auf dem Knust in Bochum-Kirchharpen und in den Befunden aus der Ziegeleigrube am Castroper Hellweg an der Gemarkungsgrenze Harpen-Grumme zu sehen. Auch am Hofe Benking in Bochum-Hiltrop vermuten wir eine Rössener Siedlung. Ob die früher entdeckte Siedlung in der Wintermannschen Ziegelei in Bochum-Altenbochum der jüngeren Linearbandkeramik oder der Rössener Kultur angehört, steht nicht fest.
Aufschlußreich waren sodann unsere Ausgrabungen in der Siedlung des deutschen Katholikentages, Bochum 1949, auf einer flachen Anhöhe (Südwestteil des Rosenberges) in Bochum-Harpen, die von der Stadtverwaltung Bochum finanziert wurde. Hier kamen Siedlungsgruben sowohl des bandkeramischen Kulturkreises, wie auch einer noch nicht näher erkannten jungsteinzeitlichen Kultur vor. Die Siedlungsgruben der letzteren lagen hinter einem kreisrunden Palisadenzaun, wie wir aus einem Fundamentgräbchen für die Palisaden schließen. Von dem Palisadenzaun, der eine Fläche mit rund 50 m Durchmesser umschloß, konnten wir nur das südwestliche Viertel sicher erfassen. Offenbar haben wir hier eine befestigte Siedlung vor uns, der ersten in Westfalen! Nach den Scherbenfunden zu rechnen, die sich von denen des bandkeramischen Kulturkreises grundlegend unterscheiden, dürfte eine Siedlung einer westeuropäischen Jungsteinzeitku1tur vorliegen. Auch diese Ausgrabung fand zusammen mit dem Landesmuseum statt.
Nach den Rössener Leuten scheint die nordische Kultur der Großsteingräber in unser Gebiet ihre Fühler ausgestreckt zu haben, mindestens bis zum Sandgebiet der Emscher. Von Westen her sandte dann der westeuropäische Kulturkreis der Jungsteinzeit Ausläufer in das Ruhrgebiet, wie namentlich spitz- und dünnackige Feuersteinbeile und Großklingen aus diesem Material anzeigen. Gegen Schluß der Jungsteinzeit, an der Wende zur älteren Bronzezeit, stellen wir auch bei uns verschiedene Kulturen fest, die ein kleines becherähnliches Tongefäß und bestimmte Steinbeilformen führten (Becherkulturen). Als die jüngste darf vielleicht die sogenannte Glockenbecherkultur angesehen werden, aus der wir aus der genannten Ziegelei am Castroper Hellweg ein wunderschönes spitznackiges Beil aus dem grünlichgrauen Mineral Jadeit kennen (Pastor Leich). Der Übergang Jungsteinzeit zur Altbronzezeit scheint bei uns fließend gewesen zu sein, wie Einzelfunde und die Erdhügelgräbergruppe auf dem Gysenberg in Herne zu beweisen scheinen. Von der jüngsten Bronzezeit
künden zahlreiche große Gräberfelder entlang der Emscher, die wenigstens zum Teil durch die vorchristliche Eisenzeit und sogar in den ersten drei Jahrhunderten nach Christi benutzt worden sind. Erstaunlich ist es, daß im umfangreichen Bochumer Stadtgebiet bisher vorgeschichtliche metallzeitliche Friedhöfe nicht aufgefunden worden sind, obwohl sie mit Bestimmtheit erwartet werden müssen. Es liegt offensichtlich noch eine Forschungslücke vor. Anzeichen dafür ergruben wir 1950 in Bochum-Hiltrop nahe der behandelten
linearbandkeramischen Siedlung, und zwar am Westrand, wo wir ein Knochenhäufchengrab mit Boden eines tönernen Beigefäßes allein liegend im Lößboden fanden (jungbronzezeitlich, um 1000 – 800 v. Chr.). Es ist dies
anscheinend das erste vorgeschichtliche Grab im Stadtgebiet Bochum.
So etwa war der Besiedlungsgang unseres Heimatgebietes in der Jungsteinzeit wahrscheinlich ununterbrochen von der jüngeren Linearbandkeramik, durch die vorgeschichtliche Metallzeit, die frühgeschichtliche Zeit und das Mittelalter bis heute. Das Ruhrgebiet ist somit uraltes Siedlungsland.
Jahrbuch der Vereinigung für Heimatkunde Bochum
1951
Herausgegeben
Im Selbstverlag der Vereinigung für Heimatkunde Bochum
Gesamtgestaltung Presseamtsleiter Albert Lassek – Umschlagentwurf Thea Reuter, Bochum
Druck Laupenmühlen und Dierichs, Bochum, Anzeigerhaus
(Zitierhinweis 2012: Albert Lassek, Bearb.: Jahrbuch der Vereinigung für Heimatkunde Bochum 1951. Bochum 1951. Bochumer Heimatbuch Bd. 5)